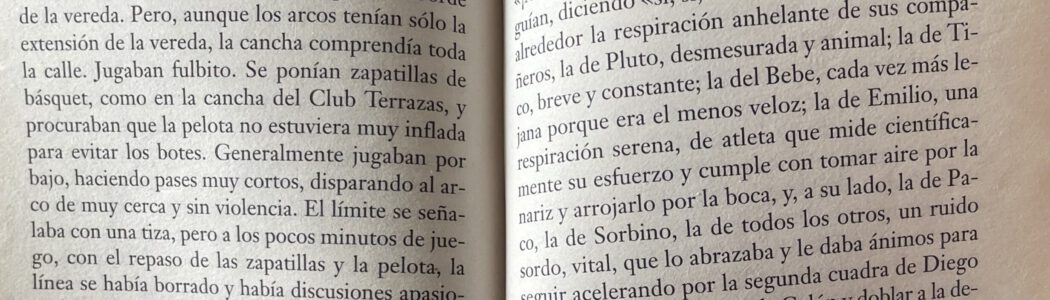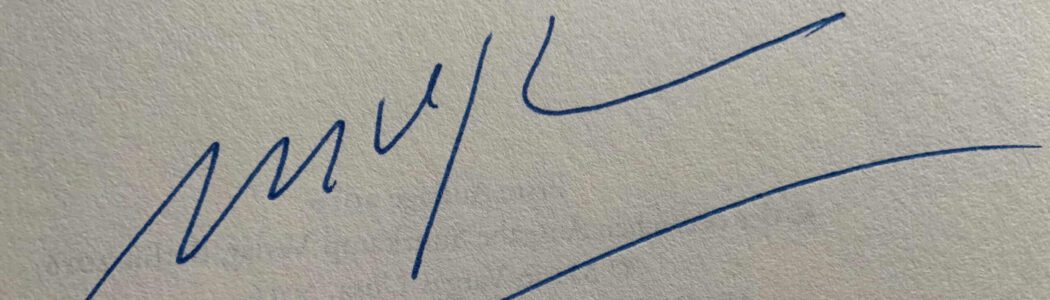Als Mario Vargas Llosa während seines Studiums in Lima bei einem Radiosender arbeitet, lernt er einen Bolivianer kennen, der Hörspiele am laufenden Band erfindet, und zwar der kitschigen Sorte. Der Mann fasziniert ihn wegen der Leichtigkeit und Unbefangenheit, mit der er schreibt, und wegen der Tatsache, dass er davon leben kann. Als dieser Vielschreiber aber dahingehend Erschöpfungssymptome zeigt, dass sich Widersprüche in seine Stücke einschleichen, kommt Vargas Llosa auf den Gedanken, über den Fall einen Roman zu schreiben: „Dies war für mich ein starker Ansporn, mir eine Geschichte auszudenken, in der ein Schriftsteller wie dieser Bolivianer, ein Seifenopernschreiber, so überproduktiv wurde, dass die Geschichte in seinem Gehirn durcheinandergerieten.“1 Bis Vargas Llosa die Idee umsetzt, vergehen allerdings 20 Jahre. Erst nachdem er beim Verfassen seines vierten Romans Der Hauptmann und sein Frauenbataillon sich für den Humor als literarisches Mittel geöffnet und mit trivialen Gattungen experimentiert hat, nimmt er das Werk in Angriff. Während eines Aufenthalts in Lima 1972 beginnt er mit der ersten Fassung und setzt diese in Barcelona fort, angelegt als Nacherzählungen von wirrer werdenden Hörspielen mit dem pikarischen Titel Leben und Wundertaten des Pedro Camacho. Doch ihm kommt das Resultat wie ein künstliches Gedankenspiel vor – nicht realistisch, wie er es für sein eigenes Schaffen anstrebt. Wie beim Vorgängerwerk Der Hauptmann und sein Frauenbataillon, dessen erste Version ihm aus denselben Grund missfällt, entschließt er sich, in den Stoff ein zweites Element einzuflechten, den Text mit einem anderen Sorte gewissermaßen auszubalancieren. „Warum nicht mich selbst einsetzen – einen Anker in der Wirklichkeit, ein autobiographisches Dokument, etwas, was so offensichtlich realistisch ist […]? Dieses Gegengewicht würde der unglaubwürdigen Welt absurder Phantasien, der Seifenopernwelt von Pedro Camacho, einen tief in der Wirklichkeit verwurzelten Kontext geben.“2 So entsteht ein zweiter Handlungsstrang aus Episoden jener Zeit, als sich Vargas Llosa mit 18 Jahren in eine zwölf Jahre ältere Verwandte verliebte und sie zum Entsetzen seiner Angehörigen heimlich heiratete: ein Stück Lebensgeschichte, das selbst „seifenopernähnlich“ war. Die Arbeit an dem Werk, in dem neben Hörspieldramen abwechseln mit den Erlebnisen einer meist „Varguitas“ genannte Figur, die schriftstellerische Gehversuche unternimmt und sich mit „Tante“ Julia liiert, dauert mit Unterbrechungen bis 1976, umfasst also auch jene Phase nach dem Wegzug von Barcelona, als sich Vargas Llosa von seiner zweiten Ehefrau vorübergehend trennte. Das Buch erscheint 1977 mit einem Titel, der das Doppelthema zum Ausdruck bringt: La tía Julia y el escribidor.3
Sprachlich überzeichnen und karikieren die Hörspielkapitel das Unterhaltungsgenre, indem sie vor sentenziösen Halbsätzen strotzen und Personen klischeehaft beschrieben werden. Bei den autobiographischen Abschnitten dagegen strebt Vargas Llosa einen sachlichen Stil an, um objektiv seine Erinnerungen zu schildern, doch lässt sich das nicht durchhalten: „Ich fühlte, dass von meiner Phantasie ein unüberwindlicher Zwang ausging, in meine Erinnerung Veränderungen einzuschmuggeln, um ein besseres Dokument zu bekommen“ (S. 139), weshalb auch dieser Werkteil nicht im eigentlichen Sinne autobiographisch ist: „Ich benutzte viele persönliche Reminiszenzen, und der allgemeine Grundriss des Geschehens, das Varguitas in dem Buch erzählt, ist mehr oder weniger autobiographisch; aber die hinzugefügten Episoden und Anekdoten sind ebenfalls zahlreich“ (S. 140 f.).
Komik durch Über- und Untertreibung
Auffällig ist das Fehlen all jener erzählerischen Merkmale, die seine bisherigen Romane ausmachen, wie die vielfachen Montagen, die Methode der aufgeschoben Information oder eindrückliche Metaphern. Dafür tritt ein neuer Zug in den Vordergrund. Das erste Kapitel fängt so an:
Damals, es ist schon lange her, war ich noch sehr jung und lebte bei meinen Großeltern in einer Villa mit weißgetünchten Mauern in der Calle Ocharán in Miraflores. Ich studierte in San Marcos, Jura, glaube ich und hatte mich damit abgefunden, dass ich meinen Lebensunterhalt später mit einem bürgerlichen Beruf würde verdienen müssen, obwohl ich viel lieber Schriftsteller geworden wäre. Ich hatte einen Job mit einem pompösen Titel, bescheidenem Salär, plagiatorischen Arbeitsmethoden und gleitender Arbeitszeit.
Statt mit einer Eröffnung medias in res in der Gegenwartsform wie in der Stadt und die Hunde, dem Grünen Haus oder der Kathedrale steigt der Erzähler mit einem Rückblick auf längst vergangene, recht allgemeine Lebensumstände ein. Zur zeitlichen Distanz kommt eine ironische: Schon im zweiten Satz lässt die Einschränkung des Ich-Erzählers, nur noch vermuten zu können, welches Fach er einmal studierte, schmunzeln, bevor die Reihung an Eigenschaften, mit der er seine Arbeit charakterisiert den Unernst fortsetzt. Der Witz entsteht dadurch, dass die Bedeutung des sprachlichen Ausdrucks die Bedeutung des betreffenden Sachverhalts entweder überraschend unterschreitet (das eigene Studienfach bloß zu vermuten statt zu wissen) oder überschreitet („Nachrichtenchef“ für eine schlecht bezahlte Abschreibetätigkeit). Nicht alle, aber viele der Pointen in der Lebensgeschichte funktionieren so. Zwei weitere Beispiele mögen das illustrieren: Den Abend, als Varguitas sich in „Tante“ Julia verliebt, erinnert er mit den Worten: „Sie trug ein blaues Kleid, weiße Schuhe, war geschminkt und vom Friseur zurechtgemacht; sie lachte laut und direkt und hatte eine rauhe Stimme und herrische Augen. Ich entdeckte ein wenig spät, dass sie eine attraktive Frau war“ ( S. 62 .f). Ihre Reaktion darauf, dass er sie später beim gemeinsamen Tanz auf die Wange küsst, beschreibt er mit den Worten: „Sie sah mich erstaunt an, als wäre ein Wunder geschehen“ (S. 64). Auch hier liegt eine semantische Unterschreitung (die Attraktivität „ein wenig spät“ zu erkennen) und eine Überschreitung (der Wangenkuss als ein „Wunder“) vor. Anders verhält es sich in den Hörspiel-Episoden, deren Sprachbilder und Vergleiche ja auch Missverhältnisse aufweisen. Die zweite Hörspielwiedergabe beginnt beispielsweise so: „In der feuchten Nacht in Callao, die so dunkel war wie ein Wolfsrachen […]“ (S. 65). Eine Nacht und ein Wolfsrachen dürften sich in punkto Dunkelheit nicht viel nehmen, haben aber miteinander sonst nichts zu tun, was diesen Vergleich stimmig machen würde; insofern liegt hier keine semantische Über- oder Untertreibung vor, sondern eine unmotivierte Querverbindung zwischen zwei disparaten Sachverhalten. Der Vergleich ist daher weniger nicht lustig als schräg.
Vordergündige und abstrakte Selbstironie
Nicht ganz ernst zu nehmen, dieses Gefühl stellt sich an vielen Stellen der Kapitel ein, in denen der Ich-Erzähler über die Herausforderungen berichtet, die sich ihm als Jüngster in der Familie, als Liebhaber der Schwester seiner Tante und als Möchtegern-Künstler stellen. Vieles davon bekommt eine sympathische Note, weil es selbstironisch ist, zumal der Ich-Erzähler und der Autor als identisch empfunden werden können. Die Begegnung mit seiner frisch geschiedenen „Tante Julia“ gestaltet er so:
„Also, du bist der Sohn von Dorita“, sagte sie und schmatzte mir einen Kuss auf die Wange. „Du bist schon fertig mit der Schule, nicht wahr?“
Ich hasste sie tödlich. Meine leichten Zusammenstöße mit der Familie damals kamen daher, dass alle mich noch wie ein Kind behandelten und nicht als das, was ich war, nämlich ein ausgewachsener Mann von achtzehn Jahren. Nichts ägerte mich so sehr wie dieses „Marito“; ich hatte immer das Gefühl, der Diminutiv stecke mich wieder in kurze Hosen.
„Er studiert im dritten Jahr Jura und arbeitet als Journalist“, erklärte ihr Onkel Lucho und reichte mir ein Glas Bier. (…)
Während des Mittagsessens fragte sie mich in jener zärtlichen Art, der sich Erwachsene bedienen, wenn sie sich an Schwachsinnige oder Kinder wenden, ob ich eine Freundin hätte, ob ich viel auf Partys ginge, welche Sport ich triebe, und riet mir mit einer Gemeinheit, von der ich nicht wusste, ob sie beabsichtigt war oder nicht, die mich jedoch mitten ins Herz traf, ich solle mir, „sobald ich es könnte“, einen Schnurrbart wachsen lassen. Das stehe den dunken Typen gut und werde es mir bei den Mädchen leichter machen.
„Der denkt nicht an Schürzen oder an Vergnügungen“, erklärte Onkel Lucho. „Er ist ein Intellektueller. Eine Erzählung von ihm ist in der Sonntagsausgabe von „El Commercio“ erschienen.“
„Passt bloß auf, dass uns Doritas Sohn nicht auf den andern Bahnsteig gerät“, lachte Tante Julia, und ich empfand so etwas wie Solidarität mit ihrem Ex-Gatten.
Neben dieser vordergründigen Selbstironie entwickelt Vargas Llosa mit der Künstlerthematik eine abstrakte, die sich aus den schriftstellerischen Äußerungen Varguitas und seinen Diskussionen darüber mit Julia und dem Freund Javier bzw. seinen Gesprächen mit dem Vielschreiber Pedro Camacho ergibt. Vargas Llosas eigene Überzeugungen, etwa dass persönliche und kulturelle ‚Dämonen‘ den kreativen Prozess bestimmen, dass sich der Dichter ganz und gar der Literatur widmen muss, dass er der Realität ein Element hinzufügt oder dass es zu einem „qualitativen Sprung“ zwischen Fiktionsebenen kommen kann, spiegeln sich hier wieder und werden mit Augenzwinkern behandelt, weil sie bei Varguitas etwas Posenhaftes haben und in Gestalt von Camacho grotesk erscheinen. Zugleich aber kann man den Roman als ernstgemeinte Metafiktion lesen, der die Wechselwirkung von Leben und Kunst und die gegensätzlichen Auffassungen von Literaturproduktion und -rezeption durchspielt und zu einer Synthese bringt. Die Geschichte endet damit, dass der intellektuell anspruchsvolle und gleichzeitig beim Publikum erfolglose Varguitas für den mit plumpen Mitteln erfolgreichen und wahnsinnig gewordenen Trivalliteraten Pedro Camacho einspringt und dessen Arbeitsplatz einnimmt – ein Bild für Vargas Llosas Ansicht, dass es um die Literatur am besten bestellt ist, wenn sie schöpferische Kunst und Massengeschmack verbindet.4
Erzählprinzip: Parallelisierung statt Montage
Das Gegensatzpaar aus literarischen Aspirationen Varguitas und melodramatischen Blockbustern Camachos steht dabei nicht alleine, sondern es wird in der Handlung gleichsam umringt von anderen Formen des Schreibens und der Unterhaltung: das Fabrizieren von Skandalnachrichten, eine Séance bei einem „Schreib-Medium“, die Kinobesuche oder der Hype um einen Bolero-Sänger. Zudem hallt das Abenteuer von Varguitas und Julia sowohl in den Radiodramen als auch in einem Prosa-Entwurf Varguitas wider. Die Parallelisierung von Szenen oder Handlungen erweist sich bis ins Kleinste: Der erste Film, den sich Varguitas mit seiner 15 Jahre älteren Verwandten anschaut, heißt „Mutter und Geliebte“, und diese Anspielung auf die beiden wird noch unterstrichen, wenn sie selbst mit nassen Haaren nach Hause gehen, nachdem die Filmfigur durch den Regenwald gelaufen ist: „nachdem wir anderthalb Stunden lang Dolores del Rio stöhnend, umarmend, liebend weinend, mit wehenden Haaren durch den Urwald laufend über uns hatten ergehen lassen, kehrten wir zum Haus von Onkel Lucho zurück. Wir gingen wieder zu Fuß, und der Nieselregen durchnässte unsere Haare und Kleider.“ (S. 18 f.) Statt wie in seinen bisherigen Romanen Handlungseinheiten oder Sprechakte mit harten Schnitten zu montieren, zieht Vargas Llosa nun weiche Parallelen durch Analogien und Spiegelbilder. Deshalb verändert er auch Einzelheiten in der autobiographisch erscheinenden Geschichte: In dem Buch lernt Varguitas seine aus Bolivien stammenden Tante am selben Tag kennen wie den Bolivianer Pedro Camacho, tatsächlich aber arbeitet Vargas Llosa beim Radio erst einige Jahre nachdem er mit Julia Urquido Illanes zusammengekommen war. Der Abend, als es zwischen den beiden funkt, war in Wirklichkeit der Geburtstag seiner Tante Olga, in der Fiktion muss es der fünfzigste Geburtstag seines Onkels sein, damit eine Parallele zu Pedro Camachos Tick, fünfzigjährige Männer zu thematisieren, entsteht.
Der Fanatiker als neuer Antiheld
Zu Pedro Camachos erstem Auftreten im Buch gehört, dass er Varguitas Arbeitskollegen zum Duell auffordert. Sein Art zu sprechen und sich zu bewegen ist zeremoniös, ihm fehlt – auffällig in diesem heiteren Buch – ausdrücklich jeglicher Humor und er widmet sich dem, was er Kunst nennt, mit heiligem Ernst. Man kann in ihm einen Don Quijote erkennen. Und das schlägt sich in seinen Fantasien nieder: Die meisten Protagonisten der Hörspiele sind Fanatiker. Die blinde und totale Hingabe an eine Aufgabe bei gleichzeitiger Humorlosigkeit, die zum Scheitern führt, war bereits dem Hauptmann Pantaleon im Vorgängerroman eigen. Vargas Llosa gestaltet also in den beiden Prosawerken, die er in den 70er-Jahren schreibt, einen neuen Typus: den tragikomischen Fanatiker. In den Büchern der 60er-Jahre spielten dagegen Zyniker den Bösewicht, an erster Stelle Cayo Bermudez in der Kathedrale, der bei aller Effizienz seine Aufgabe gleichgültig, also nicht fanatisch erledigt. Hinter diesem Rollenwechsel dürfte stehen, dass sich Vargas Llosas Weltanschauung nach 1970 wandelt. Er löst sich vom Marxismus und tendiert zu einer liberaleren und skeptischen Sicht der Dinge. Nicht mehr ein Mangel an richtiger Überzeugung, sondern ein Zuviel davon erscheint nun als Problem und Gefahr.5
Dieser Wandel wird in Tante Julia und der Schreibkünstler besonders augenfällig, weil er in derselben Epoche spielt wie das Gespräch in der ‚Kathedrale‘, dem düsteren Sittengemälde der Odria-Ära. Der Diktator wird nur einmal in dem neuen Roman erwähnt: als Fan der Seifenopern im Radio. Er hat seinen Schrecken verloren, so wie der an eine Stelle aufblitzende Rassismus oder die Verkommenheit des Skandaljournalismus Varguitas nicht mehr verbittern wie das Alter Ego Santiago Zavala.
- MVLL: Die Wirklichkeit des Schriftstellers. Frankfurt: 1997, S. 133 f. ↩︎
- Ebenda, S. 137. ↩︎
- Im spanischen Original bezieht sich „escribidor“ auf den Hörspielproduzenten Pedro Camacho und insofern auf den zweiten Strang neben dem autobiographischen. Lange Zeit hieß die deutsche Ausgabe „Tante Julia und der Kunstschreiber“, später wurde der Beriff durch „Schreibkünstler“ ersetzt. ↩︎
- Diesen Gedanken formuliert Vargas Llosa in seine Abhandlung über Flaubert, die er in derselben Zeit schrieb. Zu den vielfachen metafiktionalen Spiegelungen vgl. Sabine Köllmann: Literatur und Politik. Mario Vargas Llosa. Bern: 1996, S. 280 ff. ↩︎
- Von dieser Warte aus ist interessant, dass Vargas Llosas Erstling mit der Figur Gamboa bereits einen prinzipienhaften Charakter aufweist, der ins Abseits gerät. Stellenweise zwar klingt an, dass er seine Aufgabe übertreibt, aber die Kritik scheint sich in der Hauptsache auf die zynischen Verhältnisse zu richten.
↩︎