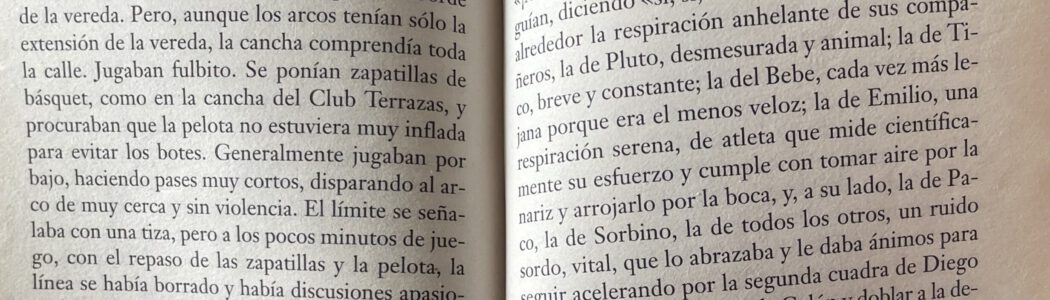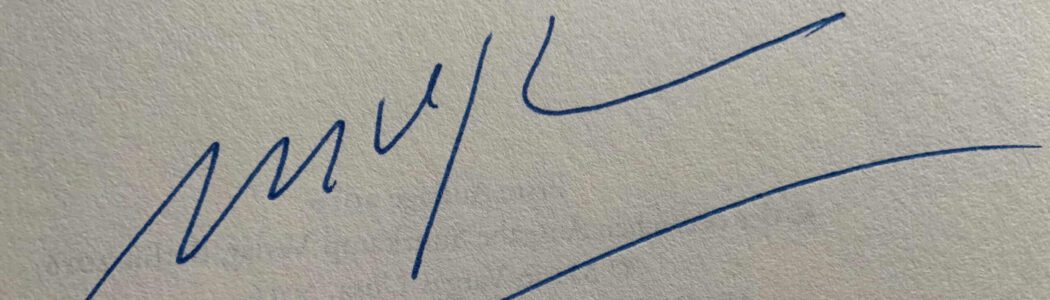Der Knabe begriff erst im Alter von zehn Jahren, wie sich Menschen fortpflanzen, und schon mit 14 geht er zu Prostituierten. Der Weg, den Mario Vargas Llosa in jungen Jahren von der Unschuld zur Sünde nimmt, ist ein kurzer – die erste Phase getragen von der mütterlichen Familie, die ihn verhätschelt, die zweite hervorgetrieben von der Sphäre des Vaters, der ihn tyrannisiert. Im bisherigen Werk hallt das in der Stadt und die Hunde wider, deren Figur Alberto zwischen romantischer Verliebtheit und käuflichem Sex pendelt, oder auch, wenn in der Kathedrale der verwöhnte Bürgersohn Santiago ein Dienstmädchen sexuell gefügig machen will. Diese Ambivalenzen werden nun verdichtet in einer Geschichte über Alfonso, einen noch nicht oder fast schon geschlechtsreifen Jungen, der seine Stiefmutter Lukrezia liebt – in des Wortes ganzer Vieldeutigkeit: von kindlicher Anhänglichkeit und mütterlicher Zärtlichkeit bis hin zum Koitus. Nicht nur dass bei der Annäherung von Kind und Frau die reine Herzlichkeit überblendet wird von verbotener Lust – am Ende scheint es so, dass der zarte, blondgelockte Jüngling ein durchtriebenes Spiel spielt, um Lukrezia aus dem Haus zu entfernen und sich als nächstes das Dienstmädchen vorzunehmen. Er gibt ein Vexierbild ab aus unschuldiger Liebe und Sündhaftigkeit, aus Engel und Teufel.
Bilder sind es überhaupt, die dieses erstaunlich raffinierte Werk prägen. Sein Ursprung war das Vorhaben Vargas Llosas und des mit ihm befreundeten Malers Fernando de Szyszlo, gemeinsam ein Text-Bild-Buch zu schaffen, um „dem Erotischen jene artistische Qualität zurückzugeben, die es in den besten Zeiten hatte, […] zum Beispiel im 18. oder noch 19. Jahrhundert“.1 Zwar funktionierte die Zusammenarbeit nicht, aber der Grundidee getreu schreibt Vargas Llosa Texte über Gemälde, die ihn als Betrachter beeindruckt haben und ums Körperliche kreisen, um sie für etwa jedes zweite Kapitel des Buchs zusammenzustellen. Es sind Worte aus der Perspektive der dargestellten Figuren. Diese narrativen Transformationen wiederum präfigurieren die jeweils benachbarten Kapitel, die insofern eine abermalige literarische Transformation darstellen. Konkret geht es um das Liebesspiel zwischen Lukrezia und Rigoberto, dem Vater, oder Alfonso, das den Malereien ähnelt. Die Sprache dieser Bildtransformationen ist ihrerseits überaus bildhaft, nämlich von barocker Metaphorik:
Dann setzte er sie rittlings auf sich, rückte sie zurecht, öffnete sie. Doña Lukrezia stöhnte, klagend und lustvoll, während ihr in einem undeutlichen Wirbel ein Bild des von Pfeilen durchbohrten, gekreuzigten und gepfählten heiligen Sebastian durch den Kopf schoss. Ihr war, als stoße man ihr mitten ins Herz. Nun hielt sie sich nicht mehr zurück. Die Augen halb geschlossen, die Hände hinter dem Kopf, die Brüste nach vorne geneigt, ritt sie auf dieser Folterbank der Liebe, die in ihrem Rhythmus mitschwang […] (S. 19)
Der Sex evoziert eine Ikone (des Sebastian) und wird als Folterung umschrieben. Wegen der Diskrepenz beider Vorstellungen – fleischliche Lust versus Heiligenbild und Martyrium – wirkt dieser Bildvergleich nicht nur kräftig, sondern auch komisch. Ähnlich funktionieren die Schilderungen der Körperpflege Rigobertos, dem zweiten Thema neben dem Geschlechtsverkehr. Die größte Fallhöhe besteht vielleicht in der Beschreibung seines Stuhlgangs:
Sein Darm war eine Schweizer Uhr: diszipliniert und pünktlich leerte er sich stets zu dieser Stunde […] Don Rigoberto schloss ein wenig die Augen und drückte sanft. Mehr war nicht nötig; er spürte sogleich das wohltuende Kitzeln im Mastdarm und das Gefühl, dass dort drinnen, in den Höhlungen des Unterleibs, etwas Folgsames sich auf den Weg machte und bereits die Richtung zu jener Ausgangspforte einschlug, die sich weitete, um ihm den Durchgang zu erleichtern. […] Man durfte die Obulusse bei ihrem Dahingleiten zur Ausgangspforte nicht drängen, sondern musste sie huldvoll führen, begleiten, geleiten.
Und so weiter. Wohl kaum wurde in der Weltliteratur so ästhetisch abgeführt. Alles in diesem Buch scheint ein und denselben Fluchtpunkt zu haben: die körperliche Wonne. Selbst Tiere und Pflanzen partizipieren am Liebestreiben: „Die Spürhunde werden uns umstreichen und mit dem Atem ihrer gierigen Schlünde wärmen und uns vielleicht erregt die Glieder lecken. Der Wald wird uns seufzen hören“( S. 71). Indem alle möglichen Lebensbereiche auf diesen Fluchtpunkt bezogen werden, geraten sie in den Strudel der Ironie, man könnte auch sagen: Der Erzähler macht sich über sie lustig im doppelten Sinn des Wortes Lust. Da ist zum einen die Politik, für die sich Rigoberto engagiert hatte, bevor ihm klar wurde, dass statt kollektiven Idealen allenfalls individuelle realisierbar sind, wenn man sie begrenzt „auf die Pflege oder Gesundheit des Körpers zum Beispiel oder auf die erotische Erfahrung“ (S.76). Weil er allen Teilen seines Leibes dieselbe Aufmerksamkeit schenkt, bemerkt er: „Mein Körper ist das sonst Unmögliche: die egalitäre Gesellschaft“ (S. 83). Diese launige Umdeutung ist unschwer als Echo auf Vargas Llosas Desillusion über den Marxismus zu erkennen. Zum anderen haben die „Waschungen“ Rigobertos einen biblischen Anklang: sie sind „der Gesetzestafel, den Geboten entnommen“ und werden eine „besondere Religion“ (S. 85) oder auch „hygienische Exerzitien“ (S. 134) genannt. Während der „Nasenritus“ Rigoberto in einen Zustand versetzt, wie er „von den Mystikern beschrieben wird“ (S. 127), assoziiert er die anstehende Liebesnacht mit Figuren der Geistesgeschichte wie den Kulturhistoriker Johan Huizinga oder Friedrich Schiller, um sich schließlich zu fragen, ob er „vielleicht das Mysterium der Dreieinigkeit gelöst“ habe (S. 134) – eine ironische Anspielung darauf, dass er seine Frau mit seinem Sohn als Beischläfer teilt, ohne es zu wissen. Die Assoziationen Rigobertos sind ein Strom geistreich-frivoler Synkretismen, und dasselbe gilt für die Auslegung der Malereien in den übrigen Kapiteln, besonders weit getrieben im Fall eines Venusbilders, wobei sich die geistliche Musik und die Frommheit eines jungen Orgelspieles mit Lüsternheit und Alchemie vermischen, sich paaren.
Schließlich verwandelt sich so etwas Harmloses wie der Schulaufsatz in ein Zeugnis sittenwidriger Intimität und bringt damit das von Rigoberto und Lukrezia gelebte Kunstgebilde zum Einsturz. Schon vorher hatte die Frau bezweifelt, ob das vollkommene Liebesglück in Wirklichkeit Bestand haben könnte, während Rigoberto sich einbildete, mit seiner Körperpflege den Verfall aufhalten könnte, den die Zeit mit sich bringt. Dass Leben und Schönheit, Kunst und Wirklichkeit inkongruent, ja letztlich unvereinbar sind, scheint als ernste Wahrheit hinter dem Divertimenti auf.
Die eingangs gezogene Parallele zwischen dem naiv-frühreifen Jüngling und Mario Vargas Llosa reicht wohl noch weiter. Der Autor, dem blonden blauäugigen Alfonso äußerlich keineswegs ähnlich, setzt am Beginn ein autobiographisches Zeichen: Die Stiefmutter trifft den Kleinen abends im Bett mit einem Buch von Alexandre Dumas an – jenen Schriftsteller, dessen Abenteuergeschichten Vargas Llosa in seiner Kindheit verschlang. Was sich entwickelt wäre Inzucht, wenn Lukrezia die leibliche Mutter wäre, doch da sie die Stiefmutter ist, kann das Verhältnis nur im übertragenen Sinn als inzestuös gelten. An der Grenze zu diesem Tabu geht auch Vargas Llosa Beziehungen ein: als Heranwachsender erobert er die Schwester seiner Tante, eine Verwandte, aber keine Blutsverwandte aus der Generation über ihm also, bevor er sich mit seiner Cousine liiert. Bei aller Artistik ist das Lob der Stiefmuter insofern ein höchstpersönliches Buch.
- Thomas Scheerer: Mario Vargas llosa. Leben und Werk. Eine Einführung, S. 163. ↩︎