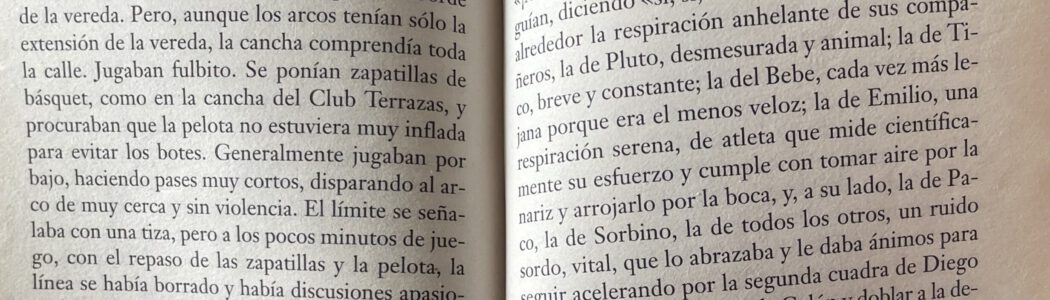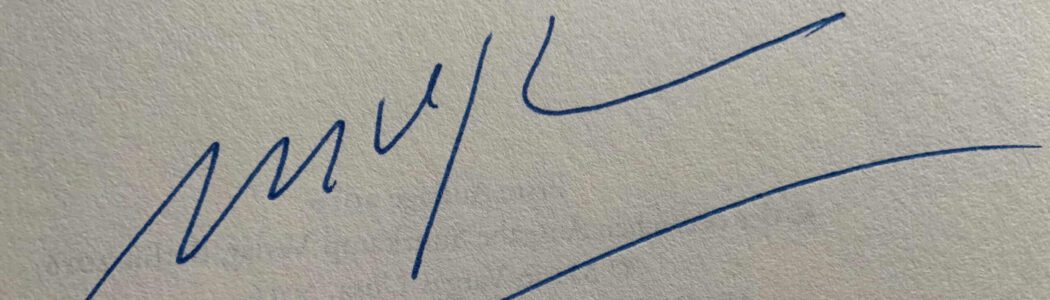Acht Jahre dauert die Diktatur des Generals Manuel Arturo Odría in Peru, von 1948 bis 1956. Mario Vargas Llosa ist am Beginn dieser Ochenio genannten Periode ein politisch unbewusstes Kind und an ihrem Ende ein marxistischer Student. Als Mitglied einer studentischen Abordnung, die im Innenministerium vorspricht, begegnet er einmal Odrias Sicherheitschef persönlich und ist so erstaunt von der apathischen und schwächlichen Erscheinung dieser im Volk gefürchteten Person, dass er beschließt, einen Roman über sie zu schreiben. Ebenfalls während der Odría-Herrschaft werden in Lima wegen einer Tierseuche Hunde von Polizisten eingefangen. Als seiner Frau Julia das Haustier entrissen wird, eilt Vargas Llosa zum kommunalen Hundezwinger und kann es zurückfordern, doch wird er Zeuge, wie andere Vierbeiner mit Schaufeln totgeschlagen werden. Um sich von dem Schrecken zu erholen, sucht er die nächste Kneipe auf, es ist Spelunke mit dem Namen ‚La Catedral‘, und hierbei kommt ihm die Idee, den geplanten Roman über die Odria-Diktatur mit einer solchen Szene beginnen zu lassen.
Das Werk nimmt er erst zehn Jahre später in Angriff, kurz vor seinem Umzug von Paris nach London. Die vielfältigen Eindrücke aus dem Ochenio lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres integrieren, bis der Schriftsteller nach etwa einjähriger Arbeit den Einfall hat, ein Gespräch zwischen der Hauptfigur und einem Angestellten im Hundezwinger zu ersinnen, das quasi eine Säule bildet, um die herum sich andere Unterhaltungen und Episoden ranken. Dieses Gespräch in der ‚Kathedrale‘ situiert der Autor aber später, nämlich ebenfalls etwa zehn Jahre nach dem Ende der Odria-Ära, sodass die Erfahrungen der beiden Figuren in der Diktatur rückschauend entfaltet und von diesen kommentiert werden können.
Dem Protagonisten Santiago Zavala gibt Vargas Llosa neben dem Hundezwinger-Erlebnis weitere Merkmale seines eigenen Werdegangs mit und stattet ihn zugleich mit einem wesentlich Unterschied zu sich selbst aus – dieses Verfahren kennt man schon von der Gestaltung Albertos im Erstling Die Stadt und die Hunde. Santiago wächst wie Vargas Llosa im gutbürgerlichen Lima-Miraflores auf, lehnt seinen Vater ab, entscheidet sich für ein Studium an der proletarischen Universität San Marcos, schließt sich dort zweitweise einer kommunistische Zelle an und verdingt sich im Boulevardjournalismus. Der Vater-Sohn-Konflikt ist allerdings anders gelagert als in der Wirklichkeit des Schriftstellers: Santiago wird verhätschelt von Don Zavala, einem erfolgreichen Geschäftsmann und Komplizen des Regimes; er begehrt zunächst gegen diese politische und die materialistische Ausrichtung seines Elternhauses auf, indem er sich kommunistischen Kommilitonen anschließt, wobei er feststellen muss, dass er deren Dogmen nicht folgen kann. Als er erkennt, dass man in der peruanischen Gesellschaft nur Erfolg haben kann, wenn man anderen schadet, lässt er den Ehrgeiz fahren, wie sein Vater Karriere zu machen, bricht das Jurstudium und die Verbindung zur Familie wie zu den radikalen Freunden ab und verdient seinen Lebensunterhalt in einer Lokalzeitung. Er glaubt an nichts mehr, und entscheidet sich für die Mittelmäßigkeit. Mit Anfang 30 blickt er resigniert auf sein Leben zurück. Er selbst bringt auf den Punkt, was seinem Leben fehlt und dass seine Entscheidungsschwäche und Reaktivität dafür maßgeblich sind – Charaktereigenschaften, die der existentialistischen Haltung des jungen Vargas Llosa zuwiderlaufen:
„Was Besseres kann einem nicht passieren, Ambrosio“, sagt Santiago. „Glauben an das, was man sagt, Gefallen finden an dem, was man tut.“ (GiK S. 150)
Es ist auf mich zugekommen, von allein, wie die Arbeit, wie alles, was mir passiert ist. Nicht ich hab die Dinge herbeigeführt. Sie haben eher mich herbeigeführt.“ (GiK S. 508)
Negativer Bildungsroman
Der Roman gewinnt mit dieser Figur eine biografische Tiefe wie kein anderes der bisherigen Werke Vargas Llosas, weshalb man auch von einem Bildungsroman (mit negativen Vorzeichen) sprechen kann. Das Scheitern und die melancholische Stagnation werden in dem Buch zugleich recht deutlich mit der Lage des ganzen Landes verknüpft, indem Santiago die schon in den ersten Zeilen gestellte Frage: En que momento se ha jodido el Perú? (Wann genau hat es Peru verkackt?), im Weiteren sich selbst stellt, d.h. sich beim Erinnern verschiedener Vorkommnisse fragt, ob dies der Augenblick gewesen sei, an dem er sein Leben vermasselt habe. Santiagos Lähmung und Hoffnungslosigkeit scheinen damit nicht nur ein Privatproblem, sondern ein generelles oder ein Generations-Phänomen1, welches auch Santiagos verkrachten Redaktionskollegen Carlitos kennzeichnet. Dieser spricht aus, was bei Santiago nur anklingt, nämlich dass er seine dichterischen Neigungen verraten hat. Insofern ist die peruanische Frustration mit einer existentiellen Frage, der Treue zu sich selbst, verbunden, mit der Vargas Llosa in seiner Adoleszenz rang und die er spätestens nach seinem Umzug nach Europa kompromisslos zugunsten der schriftstellerischen Berufung beantwortete. Während Carlitos erkennt, dass hierin seine Selbstpreisgabe besteht, aber keine Konsequenzen zieht, scheint sich Santiago dessen nicht einmal bewusst zu sein. Mangelndes Selbstbewusstsein im Sinne von Schüchternheit, wie sie sich in seinem Verhalten gegenüber Mitstudentin Aida erweist, wird ohnehin als Ursache für sein Scheitern in dem Kneipengespräch thematisiert.
Desillusioniert ist auch Cayo Bermudez, doch bei ihm führt dies nicht zur Resignation, sondern zur Skrupellosigkeit. Die Figur ist an den Sicherheitschef des Odria-Regimes angelehnt, und an ihren Machenschaften lernt man ein korruptes System kennen, in das auch Santiagos Vater als Vertreter des Wirtschaftsbürgertums verstrickt ist. In gewisser Weise wirkt diese Figur wie ein Gegenbild zu Santiago: Gemeinsam ist beiden der Bruch mit dem Vater und eine Heirat gegen Wunsch der Familie2, aber während Santiago aus der Oberschicht absteigt, kommt Bermudez aus einem einfachen Milieu und reüssiert im Staatsapparat. 3 Beide sind im Grunde politisch desinteressiert, doch während Santiago vom diffusen Idealisten zum Zauderer wird, operiert Bermudez effektiv, zweckmäßig und aus niederen Beweggründen. Jener ergeht sich selbstquälerisch in Zweifeln, dieser quält andere, sei es real oder in sexuellen Fantasien.
Forcierte Montagetechnik
Für Vargas Llosa besteht gerade bei politischen Themen die Gefahr, dass beim Schreiben wie beim Lesen die Objektivität das subjektive Element dominiert, der Roman mit der Realität verglichen wird, womit das literarische Werk seine Autonomie und Freiheit zu verlieren droht. Es habe ihn enorme Kraft gekostet, bei diesem Werk über die Odria-Diktatur völlig frei vorzugehen und seine eigene politische Meinung zu verbergen, wie er in einem Interview sagt.4 Etwas, was die Dinge in der Schwebe hält und einer allzu engen Identifaktion mit außerliterarischen Positionen vorbeugt, ist die weidlich erprobte Montagetechnik, welche der Autor noch weiter forciert. Zum einen verschränkt er nicht nur bis zu drei Gesprächssituationen miteinander (wie im Grünen Haus), sondern bis zu neun wie im siebten Kapitel des ersten Buchs der Kathedrale.5 Damit geht einher, dass personale oder raumzeitliche Gemeinsamkeiten nicht mehr eingehalten werden, also Dialoge miteinander interferieren, deren Teilnehmer nichts miteinander zu tun haben und die auch nicht zur selben Zeit oder am selben Ort stattfinden. Dafür aber zeigen sich inhaltliche Ähnlichkeiten oder Kontraste zwischen den Einheiten – womit sich ein Deutungsspielraum eröffnet. So spiegeln sich etwa in dem genannten Kapitel die Vater-Sohn-Problematik in der Unterhaltung zwischen Zavala und Bermúdez einerseits und Ambrosius und seinem Vater Trifulco andererseits, während die ebenfalls in diesem Abschnitt wiedergegebenen Wahlkampf-Besprechungen mit den Stimmen zwei Handlager des politischen Apparats bei einer Folterung unterlegt werden.
Eine neue Spielart der Dialog-Montage wendet Vargas Llosa an, indem er zwei Gespräche miteinander vermengt, an denen zwar haargenau dieselben Personen beteiligt sind, die aber zu verschiedenen Zeitpunkten und Orten stattfinden, nämlich der im zweiten Kapitel des ersten Buchs erzählte Versuch Santiagos und seines Freundes Popeye, die Hausangestellte Amalia zu verführen, indem sie ihr ein (angebliches) Aphrodisiakum in die Cola mischen, und der reuevolle Besuch der beiden nach dieser Tat, in deren Folge das Dienstmädchen seine Anstellung verloren hat, bei Amalia, wo es wiederum Cola zu trinken gibt. Die Chronologie und eben auch der Fortschritt im Verhalten der Figuren wird mit dieser zum Verwechseln einladenden Darstellung aufgehoben: der Eindruck, die beiden pubertären Jungen wären durch ihren Streich klüger geworden, wird gleichsam infrage gestellt.
Verkehrung des ‚dato escondido‘
Der zweite narrative Kunstgriff, den Vargas Llosa noch effektvoller anwendet als in seinen bisherigen Romanen, ist das Vorenthalten einer wesentlichen Information (dato escondido), was damit zusammenhängt, dass wir es hier unter anderem mit einer Kriminalgeschichte zu tun haben. Wie bei einem Puzzle setzt sich während der Lektüre die Erkenntnis zusammen, dass Santiagos Vater ein Doppelleben als Homosexueller im Rotlichtmilieu führt und verdächtigt wird, seinen Fahrer Ambrosio sexuell zu benutzen und zum Mord an einer Prosituierten angestiftet zu haben, die zuvor als Sängerin mit dem Spitznamen „Musa“ und später als „Hortensia“, als prostituierte Gastgeberin für Leute aus dem Odria-Umfeld, in dem Buch begegnet. Gewissermaßen verkehrt der Autor das Dato-escondido-Prinzip, indem er schon im ersten Kapitel die wesentliche Information andeutet, aber das ‚Drumherum‘ ausspart, sodass man sie leicht überliest: Santiago lässt bereits hier den Namen Musa fallen und fragt Ambrosio: „Hat er dich dazu veranlasst? […] War’s mein Papa?“ (GiK S. 23). Wie Vargas Llosa in einem Vortrag selbst ausführt, beabsichtigte er, der Geschichte wie einem „Thriller“ etwas Mysteriöses einzupflanzen, ein unheimliches Moment, das über dem Geschehen drohend hängt und den Leser in ein Unbehagen versetzt, bis es zu einer Auflösung kommt, die den Blick auf das zuvor Geschehene traumatisch verändere. 6 In der Tat ist die Enthüllung vom zwielichtigen Nachtleben des Vaters verstörend, da man ihn bisher als liebevollen Familienvater kennengelernt hat und er das sanftmütige Bild auch dann noch abgibt, als ihn sein Sohn vor dem Gerücht warnt, Ambrosius habe den Mord ausgeführt. Umso unheimlicher wirkt, wenn kurz danach Santiagos Bruder lakonisch berichtet, dass Ambrosius verschwunden ist, womit der Verdacht sich zu erhärten scheint. – Das Prinzip der vorenthalten Information verkehrt der Autor ebenfalls, aber auf andere Weise, ins Gegenteil, wenn er den Leser schon früh wissen lässt, dass Amalia bei einer Geburt sterben wird. Hier wird der Leser also vorzeitig über ein Unglück informiert, was im Fall von Amalia als einer der wenigen gutherzigen Charaktere geeignet ist, das Mitleid zu verstärken.
Unsichtbare Sprache
Auf der anderen Seite sind manche Stilmittel im Vergleich zu den vorangegangenen Werken zurückgenommen. Das Gespräch in der ‚Kathedrale‘ weist weder die Bildmächtigkeit wie Das Grüne Haus noch die akustische Expressivität wie Die Jungen Hunde auf. Zum einen mag das daran liegen, dass der Text die Wiedergabe eines Kneipengesprächs sein soll, in denen andere Gespräche eingebunden sind. Darüber hinaus sagt Vargas Llosa, er habe die Sprache unsichtbar machen wollen, damit man beim Lesen das Gefühl bekommt, das Geschehen zu erleben, und nicht, dass es einem erzählt werde.7
Trotzdem finden sich auch in dieser Sprache gestalterische Mittel wie Metaphern, Topoi wie der „Wurm“ im Magen Santiagos (etwa S. 117 f.), zeichenhafte Bilder (ein Raubvogel im Sturzflug auf eine Iguana, bevor er selbst von Gefängnisinsassen gesteinigt wird, am Anfang des besagten siebten Kapitels im ersten Buch, eine Werkstatt für Kindersärge, neben der die schwangere Amalia wohnt,8 „lüsterne Tierchen“ unter Straßenlaternen, die die Prostituierte Queta auf ihrer Fahrt zum Freier erblickt, S. 511) oder impressionistische Schilderungen (Mit ihrem Air von uniformierter und fleißiger Schülerin drängte sie sich durch den vollgestopften Flur, wandte ihr Gesicht, das eines großen kleinen Mädchens, in die eine, in die andere Richtung, ein Gesicht ohne Glanz, ohne Grazie, ungeschminkt, suchte etwas, jemanden, mit harten und erwachsenen Augen. Ihre Lippen entspannten sich, ihr männlicher Mund öffnete sich, und er sah sie lächeln: das grobe Gesicht wurde weich, leuchtete auf. Er sah sie auf sich zukommen: hola Aida. S. 67). Insgesamt aber setzt der Autor solche sprachlichen Besonderheiten seltener ein als in seinen vorigen Werken.
Obwohl die Verschränkung von Dialogen und Handlungseinheiten weiter entwickelt ist als im Grünes Haus, erscheinen die Hauptfiguren weniger fragmentiert, sondern plastischer, ähnlich wie man es aus Der Stadt und die Hunde kennt. Besonders eindrücklich ist das Schlusskapitel des ersten Buchs, das mit einer Art Kamerafahrt von der Universität durch das Zentrum Limas hin zu einem Gasthaus jenseits des Rio Rimac eröffnet, wo ein Geheimtreffen marxistischer Studenten (unter ihnen Santiago) stattfindet, bevor diese verhaftet werden und Santiago dank einer Intervention seines Vaters freikommt. Die Zusammenkunft der revolutionär gesinnten jungen Leute wird in zweifacher Hinsicht ironisiert: zum einen durch einen Beziehungsstreit zwischen zwei von ihnen, Aida und Jacobo, der mit genauso dogmatischer Attitüde wie die politische Dinge besprochen wird und in die Tagesordnung hineinspielt, zum anderen dadurch, dass sich beim Eintreffen der Polizei alle Vorkehrungen für diesen Fall als vollkommen wirkungslos erweisen. Das somit schon doppelbödige Geschehen bekommt dadurch eine zusätzliche Note, dass Santiago in Aida verliebt ist und ihren Konflikt mit ganz anderen Augen betrachten muss als die übrigen. Damit nicht genug: Dass kurz danach sein Vater ihn aus dem Arrest holt, während Aida und die Kameraden inhaftiert bleiben, ist eine ambivalente Wendung der Dinge, der weitere folgen, indem der Vater ihn auf der Rückfahrt scharf zurechtweist, bevor er ihm voller Zuneigung ein Auslandsstudium anbietet, woraufhin Santiago den Entschluss fasst, sich von Familie, Universität und politischen Aktivisten loszusagen. Wir erleben die Figur Santiago von verschiedensten Seiten, indem sie quasi eine Spirale an Vorkommnissen und Gefühlen durchlebt.
Ironie in einer Skala von Zynismus bis Liebe
Die Vermischung von revolutionären Aspirationen und Pärchenzank hat zugleich etwas Komisches, und dieses Merkmal eignet weiteren Stellen des Buches, vor allem im Zusammenhang mit den kommunistischen Studenten, von denen einer lustigerweise Washington heißt, wie die Kapitale des Kapitalismus. Im Grunde genommen ist schon der Name dieses Romans ein Witz: Gespräch in der ‚Kathedrale‘. Mitnichten ist der Gesprächsort ein Sakralbau, sondern eine lumpige Kneipe, die sich aber so nennt.9 Ironie und Witz bestimmen auch den Umgang zwischen Santiago und seinen Geschwistern, die ihn als Intelligenzbestie foppen. Während hierbei Konfrontation, womöglich Antipathie überwiegen, überrascht gegen Ende des Buchs ein Gespräch, dessen Humor Sympathie und in der Folge Liebe erzeugt: Santiago liegt nach einem Autounfall im Krankenhaus und bittet eine junge Pflegerin um Zigaretten, worauf diese ihm eine starke Tabaksorte bringt:
„Um Gottes willen, das ist ja eine ‚Country'“, sagte Santiago hustend. „Rauchen Sie so ein Kraut?“
„Caramba wie verwöhnt sie sind!“ sagte sie und lachte. „Ich rauch nicht. Die da hab ich geklaut, damit Sie ihr Laster nicht abzulegen brauchen.“
„Klauen Sie das nächste Mal eine ‚Nacional Presidente‘, und ich versprech Ihnen, ich bring Ihr Bild auf die Gesellschaftsseite“, sagte Santiago.
„Ich hab sie dem Doktor Franco geklaut“, sagte sie uns zog eine Grimasse. „Möge Gott Sie vor dem behüten. Das ist der antipathischste hier und außerdem ein wahnsinniger Klotz. Der verschreibt nur Suppositionen.“
„Was hat Ihnen denn der arme Doktor Franco getan?“, sagte Santiago. „Hat er Ihnen den Hof gemacht?“
„Den Hof gemacht! Das ist bei dem alten Knaben nicht mehr drin“, auf beiden Wangen bildeten sich Grübchen, und ihr Lachen war spontan und direkt, ohne Komplikationen. „Der ist so an die hundert Jahre alt.“
Nachdem Santiago von Freunden am Krankenbett besucht worden ist, erscheint die Krankenschwester wieder:
„Diese María Antonieta Pons, die da eben da war, ist das nicht eine vom Bimbambum?“
„Sie werden mir doch nicht sagen wollen, dass Sie auch die vom Bimbambum anschauen gehen?“, sagte Santiago.
„Ich hab Bilder von ihnen gesehen“, sagte sie und ließ ein schlängelndes Lachen los. „Und diese Ada Rosa, ist das auch eine vom Bimbambum?“
„Aha, Sie haben also gehorcht“, lachte Santiago. „Haben wir sehr unanständige Ausdrücke benutzt?“
„Haufenweise, besonders diese María Antonieta Pons, ich hab mir gleich die Ohen zuhalten müssen“, sagte die Schwester. „Und Ihre kleine Freundin, diejenige, die Sie hat auf dem Fußboden schlafen lassen, hat die auch so ein Maul wie eine Abfalltonne?“
„Die ist noch schlimmer“, sagte Santiago. „Mit der hab ich aber nichts, die hat mich nicht gelassen.“
„Ein Gesicht wie ein kleiner Heiliger, wer hätte das für möglich gehalten: Sie sind ja ein ganz Schlimmer“, sagte sie und erstickte vor Lachen.
„Werd ich morgen entlassen?“, sagte Santiago. „Ich habe keine Lust, Samstag und Sonntag hier zu verbringen.“
„Gefällt Ihnen meine Gesellschaft nicht?“, sagte sie. „Ich werd Ihnen Gesellschaft leisten, was wollen Sie noch mehr? Ich hab dieses Wochenende Aufsicht. Aber jetzt, wo ich weiß, dass Sie mit Mamberas verkehren, traue ich Ihnen nicht mehr.“
„Und was haben Sie gegen Mamberas?“, sagte Santiago. „Sind’s etwa nicht Frauen wie alle anderen?“
„Wirklich?“, sagte sie mit blitzenden Augen. „Wie sind die denn, was tun die denn, diese Mamberas? Erzählen Sie’s mir doch, wo Sie sie doch so gut kennen.“ (GiK, S. 518 ff.)
Dieser charmante Höhepunkt im Buch folgt übrigens auf eine Sequenz mit dem Sicherheitschef Cayo Bermudez, der seiner Stamm-Hure eine zweite zuführt, damit beide ihm lesbischen Sex vorspielen. Seine Anweisungen pflegt er in harmlose Worte zu kleiden, etwa „ist euch nicht warm?“, um den Frauen zu sagen, dass sie sich ausziehen sollen, oder „seid netter zueinander“, damit ihr Tanzen lasziver wird, oder als Startbefehl: „Schau, schau (…), ihr seid schon Freundinnen“ (GiK S. 516). Auch das ist Ironie, und zwar von der obszönen und zynischen Sorte, wie sie auch diejenigen in den Folterszenen verwenden.
Die Humor-Amplitude dieses Werks ist also groß, wenngleich sein Ton auf weiten Strecken ernst ist. Wie in der Vargas-Llosa-Rezeption häufig festgestellt, folgen auf diesen dritten Roman zwei humorige: Der Hauptmann und sein Frauenbatallion und Tante Julia und der Kunstschreiber. Aus gänzlich unheiterem Himmel fallen sie wie gesehen zwar nicht, doch endet mit dem Gespräch in der ‚Kathedrale‘ eine Art Trilogie des von Vargas Llosa so genannten totalen Romans, der weite Bereiche der peruanischen Gesellschaft umfasst. Für den Literaturnobelpreisträger ist dieses Buch sein wohl bestes, oder wie der Autor 1998 im Vorwort schreibt: Ninguna otra novela me ha dado tanto trabajo, por eso, si tuviera que salvar del fuego una sola de las que he escrito, salvaría ésta.
- Vorwort zur spanischen Ausgabe 1998: „Ese clima de cinismo, apatia, resignación y podredumbre moral del Péru del ochenio, fue la materia prima de esta novela.“ ↩︎
- In dem Punkt hat Vargas Llosa der Apparatschik-Figur Bermudez einen recht persönlichen Streich seines eigenes Leben, mitgegeben: den heimlichen Eheschluss vor einem Standesbeamten in der Provinz. ↩︎
- Köhlmann, S. 87 ff. ↩︎
- Ricardi Cano Gaviria. El buitre y el ave Fénix. Conversaciones con Mario Vargas Llosa. 1972/2011. S. 63 f. ↩︎
- Wobei es hier eine Abfolge gibt, sodass nicht alle neun Einheiten nebeneinander stehen (womit die Grenzen des Verstehbaren wohl weit überschritten würden), sondern teilweise nacheinander. In dem Roman werden zumindest bis zu drei getrennter Gespräche parallelisiert, beispielsweise im Kapitel 6 des ersten Buchs, wenn Anteile aus Unterhaltungen zwischen a) Santiaga und Amborsio, b) Santiago und seinen Familienmitglieder und c) Santiago und seinen Kommilitonen alternieren. ↩︎
- https://www.youtube.com/watch?v=jBORdRfSB5A&t=3187s Ab Minute 49. Diese Denkfigur erinnert an den „qualitativen Sprung“ von objekter, realistischer Darstellung in eine subjektive, irreale (‚Häutung‘), den Vargas Llosa an anderer Stelle als einen von drei Grundtypen des Erzählens postuliert. MVLL: La novela, 1968. ↩︎
- Ebenda. ↩︎
- Die Verquickung von Tod und Geburt zieht sich durch vieleromana Vargas Llosas. ↩︎
- Einen ähnlichen Spaß kenne wir aus Die Jungen Hunde, wenn die bissge Dogge Judas genannt wird. ↩︎