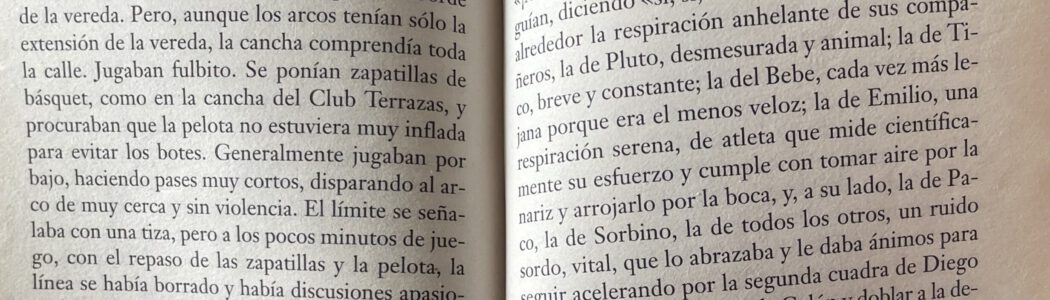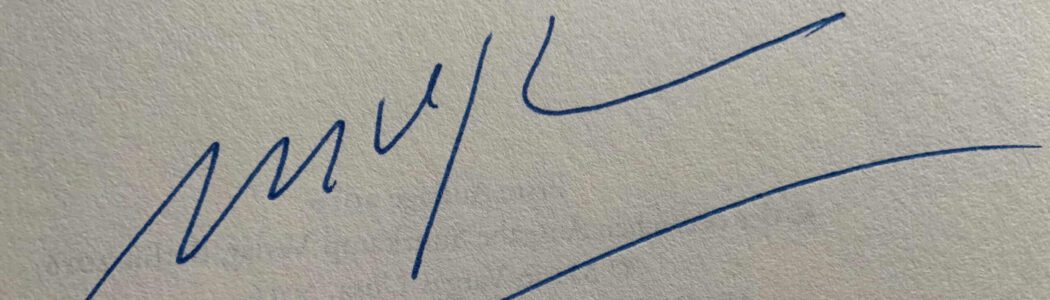Zigtausend Menschen tötete die brasilianische Armee, als sie 1897 im Nordosten des Landes die Siedlung einer Sekte vernichtete, wobei die Bekämpften ihrerseits eine hohe Zahl an Soldaten bestialisch umbrachten. Das Gemetzel beruhte auf einer ideologischen Verblendung beider Seiten: Der zum Urchristentum strebende Sektenführer und seine Anhänger wähnten sich im Kampf gegen den Teufel und die Wiedereinführung der Sklaverei, während die vom französischen Positivismus begeisterten Befehlshaber der republikanischen Armee glaubten, hinter den Aufständischen steckten Monarchisten, die von England unterstützt würden. Gerade in Intellektuellenkreisen kam diese irrige Idee auf, weil man sich nicht erklären konnte, weshalb arme Menschen gegen die Republik opponieren, die doch nur ihr Bestes will. Am vierten, vernichtenden Feldzug nahm der Journalist Euclides da Cunha teil, ein glühender Republikaner, der schließlich erkennen musste, dass man nicht britisch aufgerüstete Rebellen, sondern schlichte Bauern masakriert hatte. Seine Erlebnisse hielt er in Os Sertões fest.
Dieses Werk liest Vargas Llosa 1973, um ein Drehbuch für einen Film zu schreiben, den der Regisseur Ruy Guerra über diesen Krieg plant. Aus finanziellen Gründen kommt es nicht zur Verfilmung, sodass Vargas Llosa beschließt, den Stoff in Romanform umzusetzen. Er arbeitet daran seit 1976 und fährt im Juli 1979 ins brasilianische Bahia, um Anschauung zu gewinnen. Nach diesem Besuch schreibt er den Roman zweimal um; eine Herausforderung besteht darin, ein mit Lusitanismen versetztes Spanisch zu wählen, als Annäherung an die Landessprache. Zudem kommt dem Autor der Gedanke, die Geschichte wie einen epischen Abenteuerroman zu strukturieren, Redewendungen im Stil des 19. Jahrhundert anklingen zu lassen und manche Szenen aus großer Entfernung darzustellen.1 Abschließend recherchiert er weitere Dokumente in Archiven in Washington. Der Roman erscheint 1981 unter dem Titel La guerra del fin del mundo (Der Krieg am anderen Ende der Welt).
Was Vargas Llosa an der Geschichte rund um die Sektenhochburg Canudos fesselt ist, dass sie in seinen Augen ein in ganz Lateinamerika herrschendes Grundübel widerspiegelt: die Spaltung der Gesellschaften aufgrund intellektueller und religiöser Intoleranz, mit den Folgen von Krieg, Unterdrückung, Massaker. „Gleichzeitig fühlte ich, wenn ich einen überzeugenden Roman schreiben und Canudos als Szenerie dafür benutzte, würde ich vielleicht imstande sein, literarisch die Schilderung eines kontinentalen Phänomens vorzulegen, das jeder Lateinamerikaner als Teil seiner eigenen Vergangenheit und in manchen Fällen seiner eigenen Geschichte erkennen könnte, weil im gegenwärtigen Lateinamerika Canudos immer noch in vielen Ländern zu finden ist. In den peruanischen Anden zum Beispiel haben wir ein lebendes Canudos“, führt Vargas Llosa bei einem Vortrag in den 1980er Jahren mit Blick auf militärische Verbrechen und marxistischen Terrorismus in seinem Heimatland aus.2 Insofern wählt er zwar erstmals ein Sujet außerhalb seines eigenen Landes und seiner Lebenszeit, und dennoch eines, das damit verwandt ist. In der Canudos-Geschichte spielen denn auch Themen und Konstellationen eine Rolle, die Vargas Llosas bisherige Romane schon geprägt haben: die Kluft zwischen städtischer Moderne und archaischem Hinterland im Grünen Haus, Militarismus in die Stadt und die Hunde und im Hauptmann und sein Frauenbatallion (wo außerdem das Sektenthema bereits vorkommt), Journalismus und Unterhaltungskunst (Gespräch in der Kathedrale und Tante Julia und der Schreibkünstler). Als er erfährt, dass in der jungen brasilianischen Republik der Positivismus en vogue war, dass dort Tempel für den französischen Begründer Auguste Comte gebaut und nach Paris ausgerichtet wurden, so dürfte ihn das an seine jugendliche Faszination für Sartre und Frankreich erinnert haben.
Fanatiker und Schriftsteller
Überdies setzt sich in dem neuen Romanstoff die Figur des Fanatikers fort, welche ja in Vargas Llosas vorherigen Büchern den Antihelden abgibt. Sie wird verdreifacht: in Gestalt des „Ratgeber“ geheißenen Sektenführers, des Generals Moreira Cesar, der den dritten desaströsen Feldzug befehligt, und des schottischen Revolutionärs Galileo Gall. Letzterer ist eine importierte Erfindung, die Vargas Llosa nicht der Chronik des Bürgerkriegs in Brasilien entnahm, sondern die ihm aus seiner Beschäftigung mit dem Anarchismus in Barcelona und deren Hang zu einer pseudowissenschaftlichen Schädelkunde (Phrenologie) im 19. Jahrhundert vor Augen trat. „Das gab dem Roman eine zusätzliche Dimension – der Fremde, der nach Lateinamerika kommt, um hier sein persönliches Wunschbild, sein Utopia zu finden. Dies ist ein bedeutsamer Aspekt unserer Geschichte. Fremde, die kommen und nicht sehen, wie Lateinamerika ist, sondern so, wie sie es gern sehen möchten, damit sie ihre persönlichen Wunschvorstellungen befriedigen können. Wir haben eine lange Liste von Menschen dieser Art, beginnend mit Kolumbus. Er wollte Indien erreichen; er stolperte über Lateinamerika und sah Indien.“3
Galls ideologischer Wahn besteht darin zu glauben, in Canudos verwirkliche sich eine sozialistische Gesellschaft. Er verfasst hierüber eine Art Vermächtnis, das er an eine französische Zeitschrift schickt, die aber ironischerweise nicht mehr existiert. Zwei weitere schreibende Figuren kommen hinzu: ein an Da Cunha angelehnter kurzsichtiger Journalist, der den dritten Feldzug begleitet – auch er ist erst verblendet, dann aber bestrebt, die Wahrheit zu erkennen – und eine „Löwe von Natuba“ genannte Missgestalt, die die Worte des Ratgebers protokolliert, also starr wie Gall, aber ohne eigene Ansicht schreibt. Die Figur des Journalisten nimmt sich das vor, was der Autor Vargas Llosa mit dem Roman vollzieht: über den Krieg und seine wahren Ursachen zu schreiben. Insofern ist sie eine metaliterarische Figur, wie es der Protagonist in Tante Julia und der Schreibkünstler schon war, nur diesmal ist sie politisch engagiert. Als Gegenbild in dieser Hinsicht fungiert im Krieg am Ende der Welt ein kleinwüchsiger (also ebenfalls körperlich fehlgebildeter) Geschichtenerzähler in einem Wanderzirkus. Er erreicht wie der Journalist sein Publikum, verfolgt damit aber keinerlei inhaltliche Mission.
Zwischen den Fanatikern stehen der Baron de Canabrava als milder Konservativer und Epaminonds Goncalves als Progressiver. Beide agieren pragmatisch und flexibel, doch während der Baron dabei zu resignieren scheint, kulminiert Goncalves‘ Taktieren darin, einen Menschen heimtückisch zu instrumentalisieren: Er lässt Gall in eine Falle laufen, um ihn ermorden lassen und so einer „englische Leiche“ habhaft zu werden, mit der seine Partei die Legende von einem britischen Komplott hinter Canudos stützen soll. Der Charakter des Barons wird symbolisch untermalt durch ein Chamäleon, das der Baron durch das Fenster in seinem Garten beobachtet bzw. mit Blicken sucht, während er eine politische Diskussion an sich vorbeiziehen lässt – Ausdruck seines Rückzugs in Private und vielleicht auch seiner Haltung, sich wie ein Chamäleon den Umständen anzupassen.
Symmetrie im Personal und Kapitelaufbau
Das Figurentableau weist weitere Symetrien auf: Moreira César als General des dritten Feldzug steht General Artur Oscar im vierten als flexiblerer gegenüber, in der Sekte haben zwei Mörder namens João Grande und João Abade militärische Führungspositionen sowie ein Kaufmann Antonio Villanova und der Pfarrer Dom Joaquim organisatorische Leitungsaufgaben, und gegen Ende des Romans verhält sich der Journalist spiegelbildlich zum Baron: Er versucht nach der Canudos-Erfahrung die Wirrnisse öffentlich aufzuklären, während der Baron sie vergessen will und sich ins Private zurückzieht. Der Journalist entwickelt während der Gefangenschaft in Canudos eine symbiotisch-erotische Dreierbeziehung mit Jumera und dem geschichtenerzählenden Zwerg; nachdem er dem Baron davon berichtet, scheint dieser die Liebe mit seiner apathisch geworden Ehefrau durch einen erzwungenen Akt mit deren Bediensteter wiederbeleben zu wollen.
Eine hohe Regelmäßigkeit lässt sich ebenso im Aufbau dieses Romans erkennen, der sich aus vier Büchern mit jeweils bis zu sieben Kapiteln zusammensetzt. Diese wiederum bestehen aus Abschnitten, welche in gleichbleibender Reihenfolge unterschiedlicher Personen(-kreise) enthalten. So handelt im ersten Buch der erste Abschnitt jedes Kapitels stets vom Ratgeber, der zweite von Gall, der dritte von einem der Sektenanhänger und der vierte abermals von Gall. Das dritte und vierte Buch sind ähnlich gestrickt, nur mit anderen Personen, während das zweite Buch lediglich drei Kapitel ohne unterteilende Abschnitte umfasst und den Journalisten bzw. einen seiner Zeitungsartikel wiedergibt. 4
Rückkehr zur Bildhaftigkeit
Das Schema erinnert an das Grüne Haus, welches sich ebenfalls in mehrere Bücher gliedert, innerhalb deren die Handlungsabschnitte in weitgehend gleichbleibender Reihenfolge präsentiert werden. Die beiden Werke ähneln sich zugleich sprachlich darin, dass sie visuelle Reize und Farbtupfer setzen – anders als die nüchterner gehaltenen Romane dazwischen. So beginnt Der Krieg am Ende der Welt mit einer eindrücklichen Beschreibung des Sektengründers:
Der Mann war hochgewachsen und so mager, dass er immer wie im Profil wirkte. Seine Haut war dunkel, seine Knochen vorstehend und seine Augen brannten in immerwährenden Feuer. Er ging in Hirtensandalen, und das violette Gewand, das lose an seinem Körper herabfiel, erinnerte an die Tracht der Missionare, die von Zeit zu Zeit die Dörfer des Sertão aufsuchten, Mengen von Kindern tauften und die in wilder Ehe lebenden Paare trauten.
Die schon das Frühwerk auszeichnende bildhafte Beschreibung des Augenausdrucks ist hier in eine oxymarotische Metapher gesteigert, die noch ungewöhnlicher ist als das grüne Funkeln der Pupillen von Bonifacia im Grünen Haus: „Manchmal weinte er, und im Weinen verstärkten schreckliche Blitze das schwarze Feuer seiner Augen.“ Diese Bildhaftigkeit überträgt sich auf die Beschreibung der Welt („zu der Stunde, da der Himmel im Norden Brasilien, ehe er dunkelt und sich bestirnt, zwischen bauschigen weißen, grauen oder bläulichen Wolken in Flammen steht und dort oben so etwas wie ein weit gestreutes Feuerwerk über die Unermesslichkeit der Welt abbrennt“), bevor im zweiten Kapitel wieder von den Augen, die „wie von einer inneren Explosion“ leuchten, die Rede ist.
Farbig, zuweilen filmisch muten über das ganze Werk verstreute Beschreibungen an, wie Menschen durch die Landschaft ziehen oder Kämpfe und Schlachten ablaufen. Es wechseln Panoramablick und Nahaufnahme, Charakerstudie und Überblick miteinander ab, nicht unähnlich wie in Tolstois Krieg und Frieden. Eine Schlüsselszene ist der fatale Angriff auf Canudos, bei dem der Starrsinn, die ideologische Überschätzung und zugleich die Hitzköpfigkeit des Generals Moreira César sinnfällig werden. Der Heerführer meint, das Blatt wenden zu können, in dem er sich heroisch in die Schlacht wirft. Er wird nach nur wenigen Momenten schmählich vom Pferd geschossen, und noch während er die letzten Atemzüge tut, gibt zu er Protokoll, aus „historischer Verantwortung“ einen Rückzug seiner Truppen abzulehnen. (Buch IV, Kapitel 7). Bei der Schilderung der Kämpfe unmittelbar vor diesem Ereignis gehen Detailbetrachtung und Fernblick gehen ineinander über, als würde man einen Farbfilm sehen, für den die Kamera von der Totale in die Nähe und zurück schwenkt:
„Die Soldaten laufen, rutschen, springen über die Abhänge, schießen. Auch die Bergflanken überziehen sich allmählich mit Rauch. Das blau-rote Käppi Moreira Césars hebt und senkt sich zustimmend. Der Journalist geht die paar Meter, die ihm vom Chef des Siebten Regiments trennen, hinunter. Er hockt sich in eine Mulde zwischen den Offizieren und dem weißen Pferd, das eine Ordonanz am Zügel hält. Er fühlt sich fremd, hypnotisiert, und der absurde Gedanke schießt ihm durch den Kopf, dass er gar nicht sieht, was er sieht. Ein leichter Wind beginnt die bleigrauen Rauchbuckel über der Stadt zu zerstreuen; er sieht sie dünner werden, zerfließen, abziehen in Richtung auf das offene Gelände, wo die Straße nach Jeremoabo sein muss. Jetzt kann er den Vormarsch der Soldaten verfolgen. Die rechts von ihm haben den Fluß erreicht und beginnen ihn zu überqueren; die roten, grünen, blauen Figürchen werden grau […]
Hinter dem kühlen Ernst, mit der die Geschehnisse im Krieg am Ende der Welt erzählt werden, tritt zuweilen eine sarkastische Ader hervor. Etwa wenn am Ende die Blähungen des Sektenführers als heilige Botschaft aufgefasst werden oder wenn beschrieben wird, wie ein homosexueller Soldat einen Kameraden bei der Notdurft beobachtet und ihn „die weißen Arschbacken, die in der Luft des frühen Morgen schwebten wie ein Aufforderung“, erregen (S. 672).
Vom uneigentlichen zum tatsächlichen Animalismus
Den Roman durchzieht ein Motiv, das schon in der Stadt und die Hunde angelegt ist, aber an Drastik gewinnt: die Überschreitung vom Menschlichen zum Tierischen bzw. die Vermengung von beidem. Im Erstling spielt sich das hauptsächlich im Metaphorischen ab, angefangen bei Tiernamen für Menschen und der Bezeichnung der Kadetten als „Hunde“, geht aber ins Tatsächliche über, wenn ältere Schüler jüngere zwingen, sich wie Hunde zu belecken, oder wenn im Monolog eines der Kadetten sodomistische Praktiken anklingen. Aber selbst diese Phänomene haben noch etwas Uneigentliches, Schauspielerisches. Im Krieg am Ende der Welt dagegen wird der Animalismus handfest und grausig: Ausgehungerte Hunde und Ratten fressen in der Endphase der Belagerung Menschen, und Praxis beider Kriegsparteien ist es, dem Feind (den die Sektenanhänger Teufel, Drache oder Hund nennen) die Kehle durchzuschneiden, ihn also wie ein Tier zu keulen. An einer Stelle wird berichtet, dass die Sektierer einer schwangeren Frau, die bei den Soldaten gearbeitet hat, den Bauch aufschneiden, das Embryo herausholen und „statt dessen einen lebendigen Hahn“ hineinstecken (S. 150). Sind dies Beispiele animalischen Menschentötens, so begegnet im Roman auch ein Fall von animalischem Menschenzeugen:
João Grande wurde am Meer geboren, auf einer Zuckerrohrplantage an der Bucht, deren Besitzer, Cavalheiro Adalberto de Gumucio, ein großer Pferdeliebhaber war. Er rühmte sich, die feurigsten Hengste und die Stuten mit den feinsten Fesseln von ganz Bahia zu besitzen und die Exemplare ohne englische Zuchthengste erzielt zu haben, nur durch kluge, stets von ihm selbst überwachte Paarung. Dass er das gleiche auch mit seinen Skalven machte, dessen rühmte er sich (öffentlich) weniger […] Sein Auge und seine Inspiration diktierten ihm das Verfahren. Es bestand darin, die am schönsten gewachsenen und geschmeidigsten Negerinnen auszusondern und sie von Negern beschlafen zu lassen, die er aufgrund ihrer harmonischen Züge und leuchtenden Hautfarbe als die reinsten bezeichnete. Die besten Paare wurden besonders ernährt und erhielten Arbeitserleichterungen, damit sie in der Lage waren, möglichst oft zu befruchten.
Auch hier bekommt der Erzählton in einen sarkastischen Beiklang. Der Sklavenjunge wird später seine Herrin barbarisch töten, bevor er auf den Wanderprediger trifft und ihm „wie ein scheues Tier“ folgt (S. 46). Mit im Gefolge ist ein „irrtümlich aus Menschen geborenes Tier“ (S. 344 ): der schreibkundige, aber vierfüßig gehende und mit einem übergroßen Zottelkopf ausgestattete „Löwe“.
Innigkeit in Anbetracht des Todes
In einer Lazarettszene gegen Ende des Buchs erscheinen die Dehumanisierung und die Absurdität dieses Krieges wie unter einem Brennglas – die Darstellung reicht an die Dichte und Vielschichtigkeit heran, die der Leser aus den meisterhaften Szenen in der Kathedrale oder der Stadt und die Hunde kennt: Die Soldaten, von denen es vorher lapidar geheißen hat, dass sie auf Feldzügen „Steine zu essen gelernt haben“ (S. 260), bekommen mangels Nahrung „Pferdefutter“. Ein Medizinstudent, der die Verwundeten versorgt, empfindet sich nicht als Ersthelfer, sondern als „Sägewerker“, weil er erst mit, dann ohne Betäubungsmittel täglich Gliedmaßen amputiert und mit Schießpulver oder brennendem Fett die Schnittflächen kauterisiert. Manche Patienten werden innerlich von Ameisen zerfressen, die Kinder des Gegners im Feldlager aussetzen. Einem Befallenen gibt der Mediziner ein Placebo und sagt ihm wider besseren Wissens, aber zur Beruhigung, seine Wunden würden schon besser aussehen. Dann schallen allabendlich die Glocken und Ave-Marias aus Canudos herüber und die Versehrten bekreuzigen sich, „sie beten zur gleichen Zeit wie ihre Feinde“ (S. 580). Ein Leutnant, der unter Beschuss Hände und Augenlicht verloren hat, bittet den Medizinstudenten zu sich, um mit ihm vertraulich zu sprechen:
„Bei allem, was du in dieser Welt achtest, bitte ich dich“, sagt Pires Ferreira leise und fest, „bei Gott, deinem Vater, deinem Beruf. Bei deiner Braut, für die du Verse schreibst, Teotonio.“
„Was willst du, Manuel da Silva?“, murmelte der junge Mann, unwillig das Gesicht von dem Verwundeten abwendend, da er genau weiß, was er hören wird.
„Einen Schuss in die Schläfe“, sagt die leise feste Stimme. „Aus tiefster Seele bitte ich dich darum.“
Er ist nicht der erste, der so etwas von ihm verlangt, und er weiß, er wird nicht der letzte sein. Aber er ist der erste, der ihn so ruhig und undramatisch darum bittet.
„Ich kann es ohne Hände nicht tun“, erklärt der Mann mit dem verbundenen Kopf. „Tu du es für mich.“
„Verlier den Mut nicht, Manuel da Silva“, sagt Teotonio und merkt, dass er es ist, dessen Stimme vor Ergriffenheit schwankt. „Verlange nicht von mir, was gegen meine Grundsätze und meinen Beruf geht. […]
„Es ist nicht leicht sich umzubringen, wenn man keine Hände und keine Augen hat“, fährt Pires Ferreira fort. „Ich habe versucht, den Kopf gegen Stein zu schlagen. Es nützt nichts. Auch nicht, den Boden aufzulecken; es gibt keine Steine, die man schlucken könnte, und…“
„Sei still, Manuel da Silva“, sagt Teotonio und legt ihm die Hand auf die Schulter. Aber es kommt ihm heuchlerisch vor, einen Mann zu beruhigen, der vollkommen ruhig ist, der weder laut noch hastig spricht, der von sich wie von einem anderen redet.
„Hilfst du mir? Ich bitte dich darum, im Namen unserer Freundschaft. Eine Freundschaft, die hier entstanden ist, ist etwas Heiliges. Hilfst du mir?
„Ja“, murmelte Teotonio Leal Cavalcanti. „Ich helfe dir, Manuel da Silva.“
Später erfahren wir, dass der junge Mediziner dem Leutnant den Wunsch erfüllt. Es ist eins der wenigen Beispiele von persönlicher Nähe, Innigkeit in dem Buch5, vergleichbar mit freundschaftlichen Momenten zwischen Alberto und dem „Sklaven“ in Die Stadt und die Hunde oder dem Lotsen Nieves und dem Sargento Lituma im Grünen Haus. Der Freundschaftsdienst steht diesmal jedoch im Zeichen des Todes.
Perspektivenwechsel statt Montagetechnik
Zu seiner Montagetechnik, auf die er im Vorgängerwerk Tante Julia und der Kunstschreiber verzichtete, kehrt der Autor in begrenztem Maße zurück. Im Schlussteil changiert der Dialog zwischen dem Journalisten und dem Baron mit früheren Ereignissen in Canudos, ähnliches geschieht in den Unterhaltungen zwischen dem Journalisten, Jurema und dem Zwerg. Ansonsten wird weitgehend chronologisch erzählt, weshalb die Lektüre leichter ist als bei dem Grünen Haus oder der Kathedrale. Die Erzählweise im Krieg am Ende der Welt zeichnet sich dafür durch ein anderes Verfahren aus: Die mehrfache Darstellung ein und desselben Ereignisses, beispielsweise Kampfszenen, aus verschiedenen Betrachterstandpunkten. Man kann den Perspektivenwechsel als literarisches Gegenteil werten zum einseitigen Missverständnis in der gespaltenen Gesellschaft, in welchem Vargas Llosa ein Kardinalproblem Lateinamerikas erblickt.
- MVLL: Die Wirklichkeit des Schriftstellers, S.166 f. ↩︎
- Ebenda, 162. ↩︎
- Ebenda, S. 169. ↩︎
- Vgl. Sabine Köllmann: Literatur und Politik. Mario Vargas Llosa, S. 130 ff. ↩︎
- Andere kann man sich zwischen dem Bauernmädchen Jurema, dem Zwerg und dem Journalisten vorstellen, jedoch wird dieser Aspekt weniger ausgestaltet. ↩︎