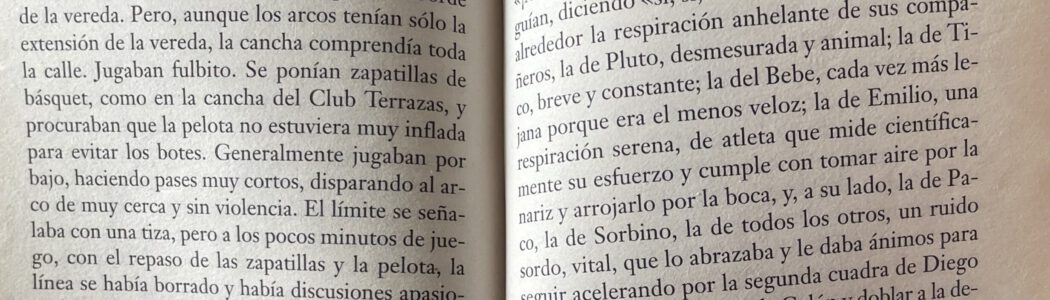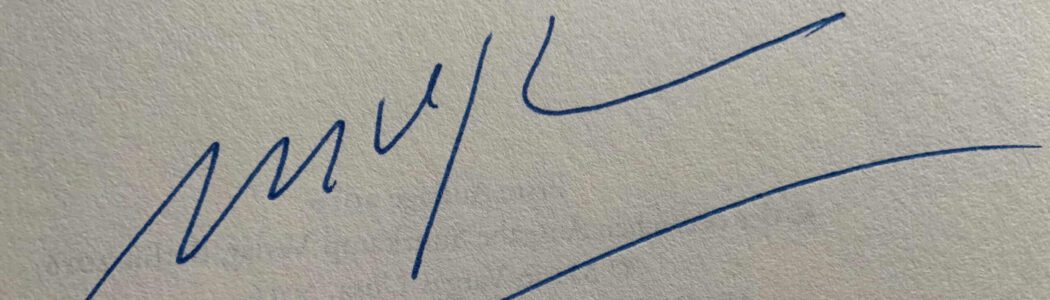Dem Kurzroman Wer hat Palomino Molero umgebracht? lässt Vargas Llosa nach nur einem Jahr ein ebenfalls vergleichsweise schmales Buch folgen. Beide Prosastücke wirken wie Seitenflügel des Grünen Hauses, des zweiten großen Romans, indem sie im einen Fall an dessen Piura-Teil, im anderen an dessen Schauplätzen im Regenwald anschließen. Mit dem Geschichtenerzähler unternimmt der Autor also noch einmal den Versuch, sich der Welt der peruanischen Selva und der indigenen Kultur anzunähern, und ruft dabei die für die Entstehung des Grünen Hauses wichtige Figur Jum ins Gedächtnis. Strukturell aber orientiert er sich am Muster derjenigen Romane, die er nach dem Grünen Haus in der 70er und 80er-Jahren geschrieben hat: Wieder begegnen wir einem regelmäßigen Wechsel zwischen zwei Genres (nämlich die Erinnerung eines Intellektuellen einerseits und die Legenden aus Mund eines Urwaldbewohners andererseits), wieder einem mit dem Autor identisch scheinenden Ich-Erzähler, der seine Versuche, die Mythen der Eingeborenen zu literarisieren, darlegt, wodurch eine selbstreferentielle bzw. metaliterarische Konstellation entsteht, und abermals einem Fanatiker: Saul Zuratas, einem ehemaligen Mitstudenten des Erzählers, der sich für die Rechte der Indios aufreibt und Lebenschancen wie ein Stipendium für ein Studium in Europa ausschlägt. Allerdings, und das ist neu, scheitert dieser nicht, sondern findet einen Weg oder zumindest einen Ausweg, indem er als Geschichtenerzähler in die Gemeinschaft der Machiguenga-Indianer eingeht.
Halbwegs zum Ziel gekommen, das könnte man auch über den Ich-Erzähler sagen, der mit diesem Buch seinen Wunsch, indigene Mythen literarisch umzusetzen, realisiert: Nicht indem er vorgibt, diese selbst nachbilden zu können, sondern nur, indem er eine wie er westlich geprägte Figur erfindet, die sich in den Urwald begibt und zum Geschichtenerzähler wird. Dass es sich nicht um originale Indiokultur handeln soll, wird spätestens dann deutlich, wenn sich in die Geschichten Kafkas Gregor Samsa oder der biblische Jehova mischen.
Das Buch hat über weite Strecken weniger den Stil eines Romans als den eines Essays, einer Autobiographie oder eines Berichts. So naturhaft-konkret, synästhetisch und fantasievoll die Beschreibungen des Geschichtenerzählers sind, sie kommen über eine aufzählende Zusammenfassung von Begebenheiten kaum hinaus, während die Kapitel des in Florenz weilenden Schriftstellers von einer Sachlichkeit sind, mit der sie sich wenig von theoretischen Texten Vargas Llosas unterscheiden.1 Beide Stränge in dem Buch dienen weniger dazu, Vorgänge und Personen erlebbar zu machen, als sie zu erklären, sei es animistisch bei den Machiguengas oder rational wie der Ich-Erzähler als Interviewer, Gesprächspartner oder Nachdenkender. Das Schlusskapitel endet mit einer Orts- und Datumsangabe, als wäre es ein Artikel, und von Verfahren aus seinem literarischen Werkzeugkasten wie die „kommunizierenden Röhren“ macht der Autor nur matt Gebrauch (etwa die Verschränkung eines Kneipengesprächs der beiden Hauptfiguren mit Vorgängen in der Umgebung, S. 31 ff.).
Der fiktionale Gehalt scheint weitgehend beschränkt auf die Figur Saul mit ihren deutbaren Zutaten: jüdische Abstammung (Parallele zu den umherziehenden und verfolgten Indiostämmen), Papagei (Sprache und Exotik), Leberfleck übers halbe Gesicht (zum Außenseiter verdammt). Alles andere, was der Ich-Erzähler mitteilt, ähnelt dagegen dem, was aus der Biographie Vargas Llosas bekannt ist. Ob sich auch die Begegnung mit einem „mageren Mädchen mit Brille“, die in der Florentiner Galerie Aufsicht führt, als der Ich-Erzähler dort das Foto mit dem Geschichtenerzähler im Dschungel entdeckt, so zugetragen hat? Beim dritten Besuch hält sie es für nötig, ihn darauf hinzuweisen, dass sie verlobt ist. Keine Chance für Flirts, für romantisches Spiel gar (was in anderer Weise auch für die Urwaldgeschichten gilt, deren Erotik unter dem wuchernden Phallus eines Halbgotts begraben liegt). Ohnehin scheint das Leben in dieser Hochburg einstiger Renaissance auf dem absteigenden Ast: Florenz geht in die chiusura estivale, die Sommerpause, es schließen die Cafés und die Galerie, die der Schriftsteller so gerne aufsuchte, und die Schreibwarengeschäfte, sodass er fürchtet, dass ihm „jeden Augenblick die Tinte ausgeht“ (S. 286). Er malt sich aus, wie er in der von Mücken und Hitze durchsetzten Florentiner Sommernacht – ein Abglanz der Urwaldatmosphäre – durch die Straßen zieht, Jugendliche aus aller Herren Länder beobachtet und in Gedanken doch nicht vom Machiguenga-Erzähler loskommt. Damit evoziert das Buch auf seinen letzten Seiten eine Endzeitstimmung und auch eine von Einsamkeit im Alter. Vargas Llosa datiert den Florenzbesuch auf Juli 1985 und die Endredaktion auf 1987 – also die Jahre um seinen 50. Geburtstag herum. Gleich danach nimmt er sich etwas anderes vor: den antikisierenden, aber lüsternen Roman Lob der Stiefmutter.
- Ein Ausnahme bildet das Auftaktkapitel, das eine verdichtete, spannungsaufbauende Situation gestaltet. ↩︎