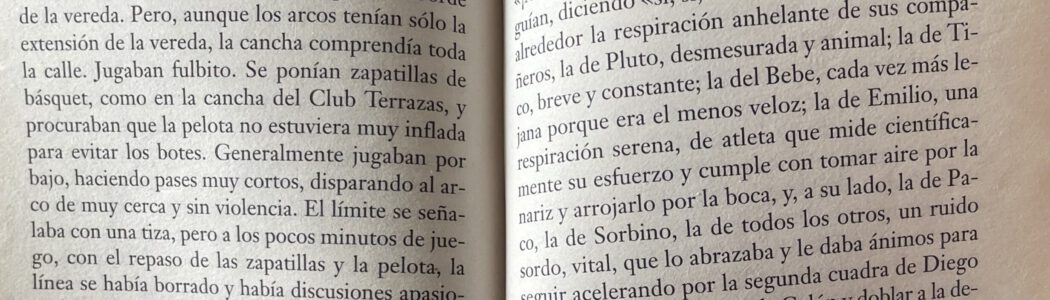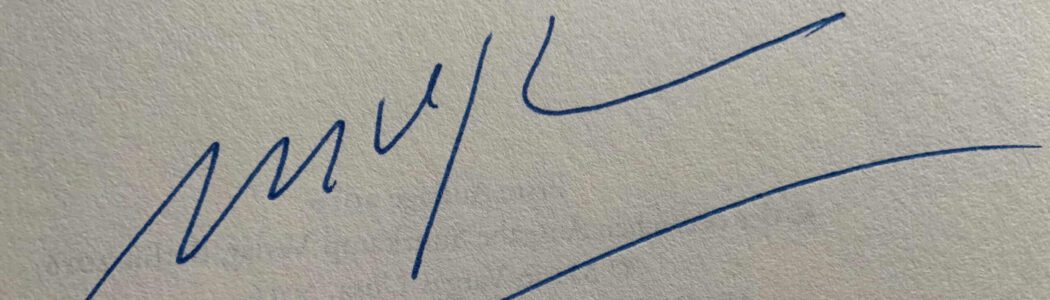Mit der Abkehr vom Sozialismus und dem kubanischen Modell verlor Vargas Llosa einerseitts wichtige Beziehungen und macht sich Freunde zu Gegnern, andererseits war er nun freier darin, seine Meinung zu äußern, ohne politische Rücksicht zu nehmen. Denn insgeheim hatte er schon vorher manches am linken Spektrum kritisch gesehen. Die Lösung von Sartre eröffnete ihm überdies eine neue Dimension beim Schreiben: den Humor, gegen den ihn der französische Philosoph nach eigenen Worten immunisiert hatte, und der die nun folgenden Werke Der Hauptmann und sein Frauenbataillon (1973) und Tante Julia und der Schreibkünstler (1978) auszeichnet.23 Danach wendet sich der Schriftsteller wieder mit weniger Ironie politischen und sozialen Themen zu, zu nennen sind Der Krieg am Ende der Welt (1981), Maytas Gesichte (1984) und Der Geschichtenerzähler (1987), zugleich aber bedient er sich dem unterhaltsamen Genre des Krimis (Wer hat Palomino Molero umgebracht?, 1986) und des erotischen Romans (Lob der Stiefmutter, 1988). Die Öffnung zu anderen Gattungen und insofern Auffächerung des Werks in dieser Lebensphase zeigt sich auch daran, das Vargas Llosa seine ursprüngliche Affinität zum Theater zur Geltung kommen lässt und in der 80er Jahren drei Dramen veröffentlicht (Die Dame aus Tacna, Kathie y el hipopótamo und La Chunga).
Auch der Habitus des im Paris der 60err Jahre mit streng zurückgekämmten Haaren, dünnem Schnurbart und enger Krawatte sich zeigenden Lateinamerikaners wird lockerer. Er lebt nun in Barcelona und kehrt 1974 in sein Heimatland zurück. Dies ist letztlich die Voraussetzung dafür, sich wieder politisch-praktisch zu engagieren, obwohl doch dem eigenen Bekenntnis nach ein Dichter allein der Literatur dienen sollte. Zusammen mit dem Ökonomen Hernando de Soto organisiert er einen Kongress in Lima, an dem Hayek teilnimmt; 1983 tritt er einer Regierungskommission zur Aufklärung von Morden an Jorunalisten in Ayacucho, dem Stammgebiet der später bis nach Lima vordringenden Terrororganisation Der Leuchtende Pfad. Vargas Llosas politische Aktivität kulminiert in der Kandidatur bei dem peruanischen Präsidentschaftswahlen 1990, die er gegen Alberto Fujimori jedoch verliert. Vorangegangen war, dass sich die sozialdemokratische Regierung anschickte, den Bankensektor zu verstaatlichen, ein aus Vargas Llosas Sicht katastrophaler Entschluss. Er ruft daraufhin mit Freunden eine marktwirtschaftlich orientierte Bewegung (Movimiento Libertad) ins Leben, die sich für die Wahlen mit konservativen Parteien zum Frente Democrático verbündete.
Piedra de Toque seit 1990
- Extemporáneos: Semilla de los sueños. Im Folgenden: ESS. ↩︎
- MVLL: Der Fisch im Wasser, Suhrkamp 1998, S. 147. Im Folgenden: FW. ↩︎
- So Vargas Llosa 2018 im ersten Teil der biografischen Dokumentation Una vida en palabras, nachdem er in früheren Lebenszeugnissen (Fisch im Wasser,Semila de lo sueños) die kindlichen Umdichtungen als Tatsache darstellte. ↩︎
- Interview mit Zeit magazin: 2011. ↩︎
- MVLL: Gegen Wind und Wetter, S. 19. ↩︎
- Den Kontakt zu Jorge Puccinelli vermittelt Carlos Araníbar, Marios Mitassistent bei Barrenechea. ↩︎
- Nachdem Vargas Llosa den Text nach erfolgloser Teilnahme an einem Erzählwettbewerb von San Marcos überarbeitet hat und diesen dem Historiker César Pacheco Vélez, der Mercurio Peruano leitet, vorschlägt. ↩︎
- Einer zugunsten von Porras Barrenechea, dem Geschichtsprofessor, für den Vargas Llosa als Student arbeitete und der für das Rektorat der Universität kandidierte. ↩︎
- Julia Urquidi Illanes: Lo que Varguitas no dijo. 2. Auflage, Grupo Editorial La Hoguera 2012 (Erstauflage 1983). S. 64. Im Folgenden: VnD ↩︎
- MVLL: Geheime Geschichte eines Romans, 1971, S. 53. Im Folgenden: GR ↩︎
- https://berlinfamilylectures.uchicago.edu/mario-vargas-llosa-writer-and-his-demons ↩︎
- Ebenda. ↩︎
- MVLL: Gegen Wind und Wetter… ↩︎
- So José Miguel Oviedo: Mario Vargas Llosa: la invencion de una realidad. Seix Barral 1982, S. 22. ↩︎
- Sergio Vilela Galván: El cadete Vargas Llosa. La historia oculta tras La ciudad y los perros. Planeta 2003, S. 72 und Fn. 27. ↩︎
- Vargas Llosa erläutert dies exemplarisch an Victor Hugos Die Elenden und Flauberts Die Erziehung des Gefühls, deren Vorstufen ohne Anreicherung den tatsächlichen Vorkommnissen entsprachen und die Autoren nicht überzeugten. MVLL: La novela, 1968. ↩︎
- Prägnant dargelegt in Contra viento y marea (i), S. 233 f. ↩︎
- Thomas M. Scheer: Mario Vargas Llosa. Leben und Werk. Eine Einführung. Suhrkamp: 1991, S. 66 ff. ↩︎
- Vgl. Sabine Köllman: Literatur und Politik. Mario Vargas Llosa, Lang: 1996, S. 10-22. ↩︎
- So Vargas Llosas nachträgliche Einordnung, u.a. im Vorwort zu Der Ruf der Horde. In seinem Bericht kurz nach der der Moskaureise geschriebenen Bericht vom Juli 1968 bemängelt er nur den weitverbreiteten Nationalismus und die Beschränkung der Kunst- und Meinungsfreiheit in der Sowjetunion. Vgl. Contra viento y marea (1) S. 205 ff. ↩︎
- Scheer: Mario Vargas Llosa. 1991, S. 177. ↩︎
- Mario Vargas Llosa in seiner Kolumne Piedra de toque in der spanischen Zeitung El Pais, zitiert nach der Übersetzung in der schweizerischen Aargauer Zeitung, 2019. ↩︎
- Bezeichnenderweise stammt Vargas Llosas erster humoriger Essay im ersten Band seiner Sammlung Contra viento y tarea vom November 1968 (dieser ironisiert ein Schriftsellertreffen in Finnland), unmittelbar nach seiner Kritik an der sowjetischen Invasion in Prag und Fidel Castros Verhalten dazu vom August deselben Jahres. ↩︎