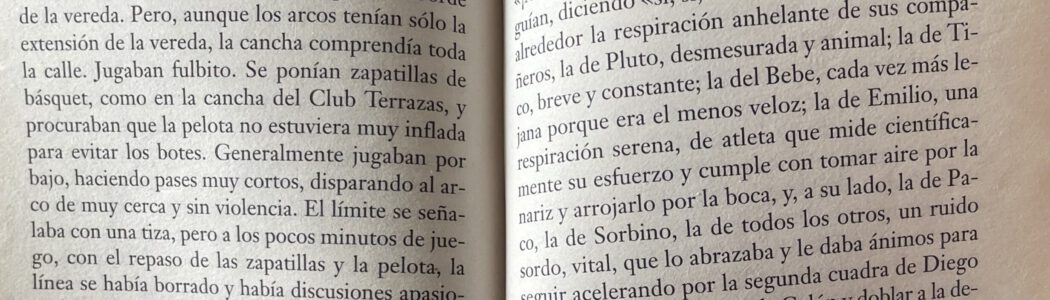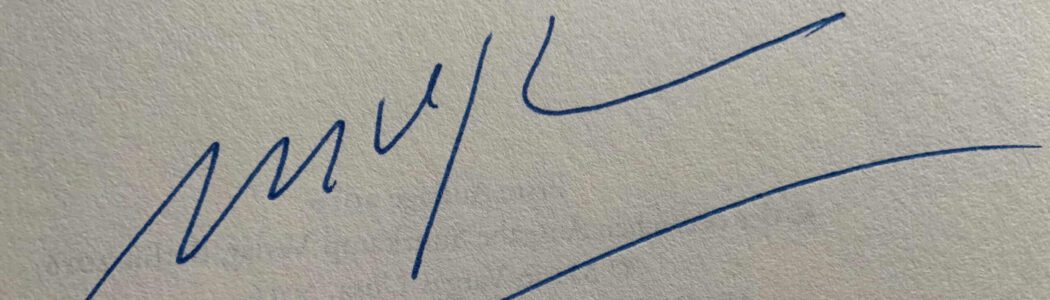Als Fidel Castro mit einer kleinen Schar eine Diktatur stürzte, um den Kommunismus zu verwirklichen, schien für Vargas Llosa wie für viele Künstler und Intellektuelle der Traum von einer gerechten Gesellschaft in Erfüllung zu gehen. Doch Castro stellte sich selbst als Diktator heraus, und dementsprechend schmerzhaft war die Abkehr vom kubanischen Modell, den zudem ein großer Teil der Generation nicht mitmachen wollte, um bis zum Untergang des Ostblocks um 1990 mit dem Sozialismus zu sympathisieren. In Peru, in das Vargas Llosa Mitte der Siebziger Jahre aus Europa zurückkehrt war, unterstützte unter anderem Kuba linksrevolutionäre Gruppen, die ab 1980 in Gestalt des Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) landesweit Terror verbreiteten, worauf der Staat mit ebenfalls inhumanen Militäraktionen reagierte.1
Vor diesem Hintergrund schreibt Vargas Llosa Maytas Geschichte. Sie beginnt übellaunig, ganz anders als das ebenfalls autofiktional angelegte, ein knappes Jahrzent vorher und damit in weniger erhitzten Zeiten entstandene Buch Tante Julia und der Schreibkünstler. Hatte damals ein Autor-Ebenbild seine jungen Jahre in Lima humorvoll erinnert, konstatiert nun die Hauptfigur beim Lauf durch die Wohnviertel am Meer derselben Stadt: „Es ist eine schöne Landschaft, vorausgesetzt, man konzentriert den Blick auf die Elemente und die Vögel. Denn hässlich ist, was der Mensch gemacht hat.“ (S. 7). Abfall, Armut, Angst und Gewalt prägen die Gegenwart dieses Romans, in dem ein (wiederum Vargas Llosa ähnelnder) Schriftsteller das Schicksal seines ehemaligen Mitschülers, der als Mitglied einer trotzkistischen Splittergruppe einen Aufstand in den Anden anzuzetteln versuchte, rekonstruiert. Der Keim dieser Geschichte wurde gelegt, als Vargas Llosa Anfang der Sechziger Jahre während seiner Phase in Paris aus der Zeitung von einer kommunistischen Revolte in der Andenstadt Jauja las und von einem Zeugen erfuhr, dass es sich um eine irrwitzig-unrealistische Aktion handelte: Die Revolutionäre bestanden aus lediglich zwei Erwachsenen (einem Kadermitglied namens Mayta und einem jungen Leutnant) sowie einer Handvoll Minderjähriger. Zunächst schwebte Vargas Llosa vor, hierüber einen politischen Abenteuerroman zu schreiben. Allerdings, so sagt er in einem Vortrag, fange er nie sofort mit dem Schreiben an, wenn er eine Idee habe, sondern denke darüber zuerst „Monate und Jahre“ nach und reichere die Idee an, bevor er sich Notizen mache und Szenen plane.2 In diesem Fall änderten sich während der Inkubationszeit zwei Dinge: Zum einen verlor der Peruaner seine Begeisterung für die Revolution nach kubanischem Vorbild, und zum anderen wuchs sein Interesse an dem Phänomen der Fiktion, welches seine Romane nach 1970 zunehmend bestimmen.
Dem Autor über die Schulter schauen
Im Vergleich zu Tante Julia und der Schreibkünstler ist das metafiktionale Spiel in Maytas Geschichte noch raffinierter: Hatte der Autor in jenem Roman seine vergangenen literarischen Versuche und Verfahren thematisiert und gespiegelt, scheint er jetzt den Leser am aktuellen Entstehungsprozess teilhaben zu lassen: Die Erzählung changiert zwischen Interviews des Schriftstellers mit Weggefährten Maytas und seiner Imagination dessen, was Mayta erlebt hat (bzw. beide Ebenen gehen schleichend ineinander über und manche Imagination wie im dritten Kapitel ist anfangs noch hölzern), bevor sich im Schlusskapitel erweist, dass auch die Interviews reine Fantasie sind.3 Der Leser kann den Einruck bekommen, dabei zu sein, wenn der Autor recherchiert und aufgeschnappte Worte reflektiert, und aus erster Hand dessen poetologische Überzeugungen zu erfahren: dass es dem realistischen Romancier darum geht, „mit Sachkenntnis zu lügen“ (S. 82), also um aus Daten „unter Hinzufügung einer reichhaltigen Dosis Erfindung so etwas wie eine unkenntliche Version des Geschehens zu konstruieren“ (S. 99), dass er alle Zeugnisse gebrauchen kann, „gleich ob sie richtig oder falsch sind“, denn es geht nicht um ihren Wahrheitsgehalt, sondern um „ihre Suggestivkraft, ihr Phantasiepotential, ihre Farbigkeit, ihre dramatische Wirkung“ (S. 122), dass seine Pflicht ist, „zuzuhören, zu beobachten, die Versionen gegeneinander zu halten, alles zusammenzurühren und [s]einer Phantasie freien Lauf zu lassen“ (S. 148), dass er alles liest, „was in den Tageszeitungen und Zeitschriften über diese Geschichte erschienen ist, und mit einer Unzahl von Beteiligten und Zeugen“ spricht, aber den Eindruck hat, umso „weniger zu wissen, was wirklich geschehen ist“, je kundiger er wird (S. 168).
Neben der literarischen Fiktion gestaltet das Buch eine politische: die auf Wunschvorstellungen beruhenden Pläne und Aktionen der (Möchtegern)-Revolutionäre, die einerseits ihren Einfluss nach außen auf tragikkomische Weise überschätzen, sich andererseits feige und verräterisch untereinander verhalten. Ihre Umtriebe um 1960 werden mit der Gewalt und Verelendung im Peru der 80er Jahre kausal verbunden, sodass man sie als Ur-Sache für die negative Romangegenwart lesen kann. Kritiker haben daher das Buch als Abrechnung Vargas Llosas mit der politischen Linken aufgefasst und darin eine literarische Schwäche gesehen.4 Hier dürften allerdings nicht nur die (gewandelten) politischen Präferenzen des Autors im Spiel sein, sondern auch die der Kritiker selbst, die sich nicht daran störten, wenn in vorherigen Prosawerken der Zynismus des Bürgertums oder des Militärs schonungslos vorgeführt wurde. Der Roman wird auch nicht dadurch parteiisch, dass er die gesellschaftlichen Probleme, aufgrund derer sich Widerstandsgruppen bildeten, genauso wenig darstellt wie andere politische Lager – diese Beschränkungen bewirken nur, dass er solche Gründe und Kontexte nicht erhellt und somit an diagnostischer Reichweite einbüßt. Problematischer ist das Konzept, wonach die Figuren reine Imaginationen des Schriftsteller-Erzählers sind und insofern seine Spielbälle. Dieser, zugleich als Alter Ego Vargas Llosas zu erkennen, ordnet das Geschehene und Gehörte ein, kommentiert es oder bewertet es implizit, weshalb der Roman zuweilen ins Sententiöse kippt.5 Das hierarchische Gefälle wird allerdings durch das Schlusskapitel gemindert, in dem der „wirkliche“ Mayta dem Erzähler begegnet und dessen Vorstellungen teilweise widerlegt. Zudem nähert sich der Erzähler seiner Figur, die er sich als ehemaligen Klassenkameraden denkt, mit Sympathie. Mayta erscheint denn auch, im Gegensatz zu den meisten seiner Mitstreiter, als integrer und altruistischer Charakter, der in jungen Jahren seine Schulspeise Armen spendet. Dem späteren Trotzkisten wird somit ein barmherziger Wesenskern zugeschrieben, schon deshalb ist dieses Buch keine einseitige Abrechnung mit der Linken. Der Sozialrevolutionär steht hier in einem milderen Licht als sein Pendant Galileo Gall im Krieg am Ende der Welt und er ist nicht weniger ambivalent als die (unpolitischen) Fanatiker in Tante Julia und der Schreibkünstler oder im Hauptmann und sein Frauenbataillon.
Semantische Wendeltreppen
Schon die zitierte Bemerkung vom Romananfang zeigt, dass der Erzähler tiefer ansetzt, als bloß eine politische Richtung zu verdammen: Seine Abscheu gilt dem, was „der Mensch“ hervorbringt. Im vierten Kapitel, als er das Inquisitionsmuseum neben dem Kongressgebäude in Lima besucht und sich beim Anblick der frühneuzeitlichen Foltermethoden die der Gegenwart (Stromstöße an Hoden, Verbrennungen mit Zigaretten) vor Augen führt, bescheinigt er Peru einen überzeitlichen Missstand: Das Museum zeige „einen wesentlichen, unveränderlichen, uralten Bestandteil der Geschichte dieses Landes: die Gewalt. Hier finden sich Moral und Physik, die Entstehung von Fanatismus und Intoleranz, von Ideologie, Korruption und Dummheit, die bei uns seit jeher mit der Macht verbunden waren“. Und angesichts abgemagerter Bettler am Treppenausgang setzt er hinzu: „Hinter mir die Gewalt, vor mir der Hunger. Hier, auf diesen Stufen, findet sich mein Land verkörpert.“ (S. 132). Dann eilt er fort, um rechtzeitig vor der Sperrstunde nach Hause zu kommen:
Es sind nur wenige Straßenzüge, aber die Gegend ist gefährlich, wenn es dunkel wird. Hier hat es schon mehrere Überfälle gegeben und letzte Woche erst eine Vergewaltigung. Die Frau von Luis Saldía – einem jungverheirateten Wasserbauingeniuer, der im Haus gegenüber wohnte – hatte infolge einer Autopanne die Ausgangssperre überschritten, da sie zu Fuß von San Isidro nach Hause gehen musste. Auf diesem letzten Wegstück wurde sie von einer Patrouille angehalten. Es waren drei Polizisten: sie zerrten sie in den Wagen, zogen sie aus – nachdem sie sie geschlagen hatten, weil sie Widerstand leistete – und missbrauchten sie. Danach brachten sie sie nach Hause und entließen sie mit den Worten: „Du kannst dankbar sein, dass wir dich nicht abknallen. “ So haben sie laut Befehl mit jedem zu verfahren, der gegen die Ausgangssperre verstößt. Luis Saldías erzählte mir das, die Augen voller Zorn, und fügte hinzu, dass er sich seither jedesmal freue, wenn ein Polizist umgebracht werde. Ihm sei es völlig egal, sagt er, ob die Terroristen siegen, denn „schlimmer als das, was wir gerade erleben, kann es nicht mehr werden.“ Ich weiß, dass er sich irrt, dass es immer noch schlimmer werden kann, dass es dafür keine Grenzen gibt, aber ich respektiere seinen Schmerz und schweige.6
Obwohl sie weniger eine Handlung als eher einen Gedankenstrom der Erzählerinstanz darstellt, ist diese Passage von Folter, über Armut, Überfällen, Polizei-Verbrechen, Todeshass auf die Polizei bis hin zur Aussicht auf noch größeren Terror eindrücklich, weil sie Bedeutungen aufschichtet und dabei quasi weiterdreht. Eine solche semantische Wendeltreppe findet sich auch im Gespräch zwischen dem Ich-Erzähler und Adelaida, der früheren Ehefrau Maytas, wenn diese über die Entdeckung von dessen wahren Neigungen spricht:
Sie sah ihn kaum, ihren Ehemann, und wusste nie, ob er auf Versammlungen, in der Druckerei oder in irgendeinem Versteck war. Maytas Leben war nicht die France Presse, dort ging er nur stundenweise hin, für einen Hungerlohn, es hätte ihnen nie gelangt, wenn sie nicht weiter in der Bank gearbeitet hätte. Sehr bald wurde ihr klar, dass Politik das einzige war, was für Mayta zählte. Zuweilen brachte er diese Kerle mit nach Hause, und dann diskutierten sie bis spät in die Nacht […] Sie hatte also viel zu leiden unter seine politischen Aktivitäten?
„Ich hab mehr darunter gelitten, dass er schwul war“, antwortet sie. Sie errötet und fährt fährt: „Mehr darunter, dass er mich geheiratet hat, um zu verbergen, dass er es war.“
Endlich eine dramatische Enthüllung. Dennoch ist meine Aufmerksamkeit unverändert geteilt zwischen Adelaida und den Fahnen, dem Blut, den Erschießungen und der Euphorie der Aufständischen und Internationalisten in Cuzco. Wird es auch in Lima in ein paar Wochen so aussehen? Der Fahrer des colectivo, mit dem ich nach Lince gekommen bin, versicherte mir, dass die Armee seit gestern nach in Villa del Salvador, Comas, Ciudad del Niño und anderen Elendsvierteln öffentlich angebliche Terroristen erschießen […]
„Anscheinend haben Sie ihm auch das nicht verziehen“, sage ich.
„Wenn ich nur daran denke, gefriert mir das Blut in den Andern“, gesteht Adelaida.
Dieses Mal? Heute nacht oder eher im Morgengrauen. Sie hörte das Auto bremsen, das Knirschen der Reifen gegenüber der Quinta, und in ihrer Angst vor der Polizei sprang sie aus dem Bett, um hinauszuspähen. Durch das Fenster sah sie das Auto: im bläulichen Licht des dämmernden Morgens stieg die gesichtslose Gestalt Maytas aus und, auf der anderen Seite, der Fahrer. Sie ging wieder ins Bett, als irgend etwas – etwas Seltsames, Ungewöhnliches, schwer zu Erklärendes, zu Definierendes – ihr keine Ruhe ließ. Sie klebte ihr Gesicht erneut an die Fensterscheibe. Denn der andere hatte ein Bewegung gemacht, um sich von Mayta zu verabschieden, die ihr nicht normal vorkam, ihrem Ehemann gegenüber. Unter Spaßvögeln, Nachtschwärmern, Kneipenbrüdern kam solch geziertes Getue ja vor. Aber Mayta war weder eine spielerische Natur, noch nahm er sich Vertrautheiten gegenüber anderen heraus. Was war? Der Typ hatte ihm, gleichsam als Abschiedsgeste, an den Hosenschlitz gefasst. An den Hosenschlitz. Er hielt seine Hand noch immer dort, und Mayta, statt ihn wegzustoßen – weg da, lass los, du bist ja besoffen –, presste sich an ihn. Er umarmte ihn. Sie küssten sich. Im Gesicht, auf den Mund. ‚Es ist eine Frau‘, wünschte sie, dachte sie, flehte sie, während sie spürte, dass die Hände und Beine ihr zitterten. Eine in Hosen und Jackett? […] Im Dunkel, halbtot vor Scham, lauschte sie auf sein Eintreten. Sie flehte, er möge in einem Zustand hereinkommen, dass sie sich sagen könnte: ‚Er wusste nicht, was er tat, wusste nicht, mit wem er es tat.‘ Aber natürlich hatte er nichts getrunken, trank er denn jemals?7
Die Vorstellungen Adelaidas von ihrem Ehepartner vollziehen mehrere Wendungen: Zunächst stellt sich heraus, dass er sich nicht für sie, sondern für Politik interessiert, dann dass die politische Kameraderie mit Homosexualität einhergeht, sogleich die Hoffnung, es wäre nicht so und er betröge sie mit einer anderen Frau, zuletzt er möge betrunken sein. Unterlegt, oder man könnte auch sagen: überlagert, wird dieser Prozess mit den Vorstellungen des Ich-Erzählers vom Kriegsgeschehen in Cusco, das wiederum mit Kampfhandlungen in Lima parallelisiert wird. Wie in den dichten Szenen seiner anderen Werke schafft Vagas Llosa eine Vielschichtigkeit an Bedeutungen und macht dabei von seinem erzählerischen Hausmittel, der Montage, intensiv Gebrauch. Es wechseln Zeitebenen, Figuren und Orte und die Erzählperspektive bzw. die Erzählerstandpunkte verschwimmen: am Ende ist kaum zu unterscheiden, ob Adelaida oder der Ich-Erzähler spricht.
Dystopie über dem Geschehen
Die Verschmelzung der Figuren begegnet bereits im vorangehenden sechsten Kapitel: Wie bei anderen Interviews des Schriftsteller-Protagonisten vermischen sich gegenwärtige Äußerungen des Gesprächspartners mit Vorkommnissen in Maytas Vergangenheit, bis der Schriftsteller-Erzähler in die Rolle Maytas schlüpft und an dessen Stelle spricht8 bzw. die Personalformen durcheinandergeraten („Während er sprach, gab er nicht zu erkennen, wie pessimistisch ich war“, S. 193). In diese Unterhaltung in einem Lokal sind Gesprächfetzen anderer Besucher eingestreut, die von der Invasion kubanisch-bolivianisch-sowjetischer Truppen und Luftangriffen der USA künden, wodurch Maytas Guerilla-Vergangenheit mit einem beginnenden Krieg verquickt wird. Anders als die Notlage in Lima, die der Ich-Erzähler in den ersten Kapiteln schildert, hat es eine solche Invasion im Peru der 1980er Jahre nicht gegeben. Vargas Llosa erstmals in seinem Romanwerk eine Dystopie.
Diese dramatische Schicht ist ein Element, das dem Buch Spannung verleiht. Andere sind die sexuellen Verstrickungen Maytas und das quasi detektivische Vorgehen der Schriftsteller-Erzählers. Durch die fantasievollen Beigaben wird aus dem einer Zeitungsnotiz entnommenen Plot eine aufregende Geschichte.
- Hierzu Wikepedia-Eintrag Terrorismus in Peru. ↩︎
- MVLL: Die Wirklichkeit des Schriftstellers. S 179. ↩︎
- Zum metafiktionalen Witz gehört auch, dass der Erzähler einem Interviewpartner versichert, seinen Namen nicht zu nennen, und ihn dabei mit Namen anspricht. ↩︎
- Vgl. Thomas M. Scheerer: Mario Vargas Llosa. Lebe und Werk. Eine Einführung. S.129 ff. ↩︎
- Vgl. Sabine Köllmann: Literatur und Politik. Mario Vargas Llosa. S. 224 ff. ↩︎
- S. 133. ↩︎
- S. 222 ff. ↩︎
- „‚Dass er zu mir gekommen ist, war das einzig Vernünftige in dem ganzen Irrsinn, auf den er sich da eingelassen hatte‘, setzte Blacquer hinzu. Er hat seine Brille abgenommen, um sie zu putzen, und sieht aus, als wäre er blind. ‚Für den Fall, dass die Guerrilla sich durchsetzen sollte, würde sie Unterstützung von Seiten der Stadt brauchen, Stützpunkte, die sie mit Medikamenten und Informationen versorgen würden, die Verletzten verstecken und behandeln, neue Kämpfer rekrutieren könnten. Stützpunkte, die ein Resonanzboden wären für die Aktionen der Avantgarde. Wer würde dieses Stützpunkte bilden? Die zwanzig Trotzkisten, die es in Peru gab?‘ – ‚In Wirklichkeit sind wir nur sieben‘, präzisierte ich.“ S. 182. ↩︎