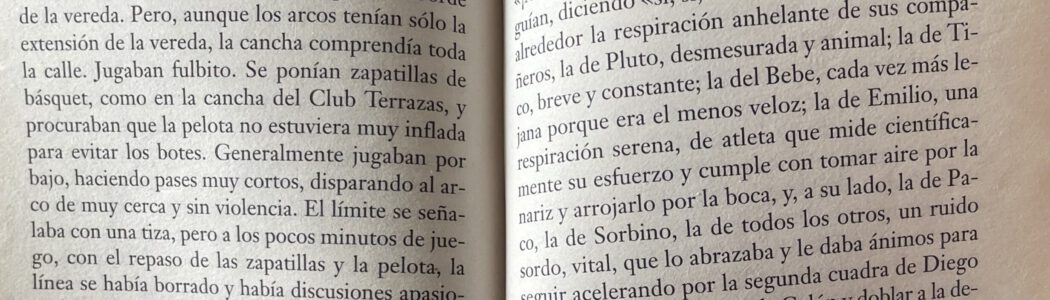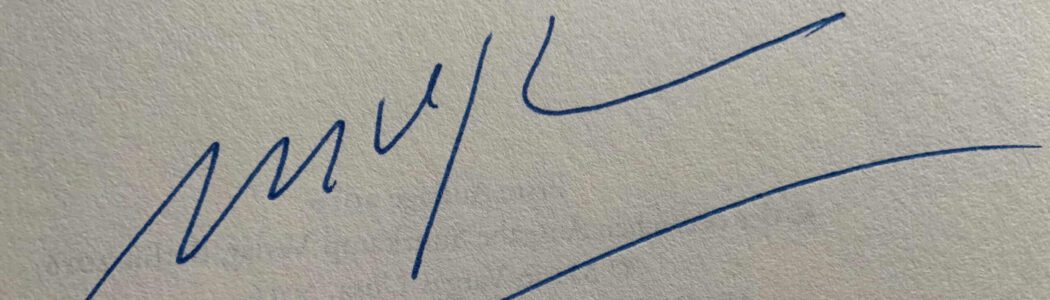Die Expedition in Perus Amazonasgebiet, die Vargas Llosa am Ende seines Studiums 1958 unternahm, war für sein Werk besonders fruchtbar. Aus der Konfrontation mit dem Schicksal missionierter Indio-Mädchen oder eines gefolterten Gemeindevorstehers erwuchs sein Roman Das grüne Haus. Daneben hatte er Begegnungen, die er zunächst nicht literarisch verwendete, wie mit Bewohnern entlegener Siedlungen, die sich erzürnten, dass ihre Frauen von im Urwald stationierten Soldaten vergewaltigt wurden. Als er einige Jahre später zu den Schauplätzen zurückkehrt, um sich zu vergewissern, dass ihm beim Schreiben des Grünen Haus keine Idealisierungen unterlaufen waren, hört er wieder vom Unmut der Einwohner, nur diesmal ist ihr Grund ein anderer: Sie fühlen sich benachteiligt, weil sie von einem Service ausgeschlossen sind, den die Behörden eingerichtet haben, um den sexuellen Übergriffen abzuhelfen: die Versorgung der Armeestützpunkte mit Prostituierten aus der Stadt.
Komik durch Kontraste und Übertreibung
Vargas Llosa beabsichtigt etwa acht Jahres später, 1972, – er lebt inzwischen in Barcelona – diese nichtverarbeiteten Eindrücke aufzugreifen, und zwar genauso ernst wie in seinen bisherigen Büchern, von denen das erste die Gemengelage aus Militäreinrichtigung und erotischen Umtrieben schon enthielt. Doch er stellt fest, dass ihn der Stoff „ins Humorvolle, zur Komödie, zur Groteske, in ironisch oder sardonisch gefärbte Situationen drängt“.1 Die Komik entsteht durch den Kontrast zwischen militärischer Form und sexuellem Anliegen, den der Autor hervorkehrt, indem er als Hauptfigur einen besonders pflichtbewussten Hauptmann gestaltet, der Prostituierte für einen „Truppenbesuchsdienst“ rekrutiert und sich dabei der Methoden der Armee, ihrer bürokratischen Sprache oder Rituale (Hymne, Musterung etc.) bedient. Dass der Hauptmann zugleich als werdender Familienvater und Muttersöhnchen auftritt und es liebt, wenn ihm seine Frau und später eine der Huren am Ohrläppchen knabbert, verstärkt die Komik noch. Allerdings bestehen diese Kontraste über das ganze Buch sozusagen als running gag fort, weshalb sich ihr Lacheffekt bald erschöpft.
Als weiteres Mittel humoriger Darstellung dient Vargas Llosa die parodistische Übertreibung: Er karikiert Stereotype, aber auch die Unwahrhaftigkeit, in Rundfunksendungen und Zeitungsreportagen, von denen der Roman Kostproben gibt, oder im privaten Tratsch, sei es in Gesprächen oder in einem Brief der Ehefrau an ihre Schwester. Eine klischeehafte, aus Versatzstücken gedrechselte Sprache zu entlarven ist ein Spaß, den der Autor in seinem nächsten Roman Tante Julia und der Schreibkünstler noch weitertreiben wird.2 Grotesk überzeichnet werden zudem Personennamen3 oder Eigenheiten wie der Hang zu Abkürzungen bei der Armee.
Mit der so entstehenden Geschichte Der Hauptmann und sein Frauenbataillon habe er eine beträchtliche Wendung vollzogen, nämlich den Humor in der Literatur entdeckt, erklärt Vargas Llosa. Zuvor hatte er beides für unvereinbar gehalten, vermutlich wegen Satre und des französischen Existentialismus, die ihn in frühen Jahre stark beeinflussten. „In meinen ersten drei Romanen gibt es keinen Humor, und wenn er doch einmal auftaucht, ist das ohne mein Zutun und einfach von selbst geschehen“, stellt der Autor fest.4 Tatsächlich finden sich entsprechende Ansätze im Frühwerk, man denke an Tiervergleiche in der Stadt und die Hunde oder lachhafte Situationen im Gespräch in der ‚Kathedrale‘, doch steckt dahinter also keine humoristische Absicht. Andererseits qualifiziert Vargas Llosa den Humor im Frauenbatallion als „ein wenig rauh und vulgär und sehr direkt“.5 Das soll sich mit dem darauffolgenden Werk ändern.
In dem Jahr, als er an dem Roman arbeitet, besucht Vargas Llosa noch einmal die peruanische Amazonasregion, um eine bessere Vorstellung von dem militärischen Sex-Service zu bekommen. In der Stadt Iquitos erfährt er dabei von einem Sektenführer, dessen zahlreiche Anhänger an einem See vor der Stadt ein großer Kreuz aufgepflanzt haben, und ihm kommt der Einfall, der Geschichte des Hauptmanns die eines Scharlatans kontrapunktisch gegenüberzustellen, denn zwischen beidem erblickt er Gemeinsamkeiten: „Vor allem ist es die fanatische, persönliche Vorstellung von einer festumgrenzten Tätigkeit, die Männer zur Zerstörung treiben kann.“ Hierin liege zugleich der ernste Kern des Buchs. Am Hauptmann wie am Sektenführer zeige sich, wie die Spezialisierung auf eine einzige Tätigkeit zu einer „bürokratischen Verkrüppelung des Denkens“, zu einer Absonderung des Spezialisten in Positionen führt, von der aus er „nicht mehr überblickt, wie sein Handeln tragische, katastrophale Erschütterungen und Auswirkungen auf andere Gebiete der Gesellschaft haben kann“. Vargas Llosa hält diese Verkrüppelung „für eines der größten Probleme in allen Gesellschaften“.6 Wenn der Hauptmann im Roman von sich selbst sagt, er brauche Chefs, denn ohne solche wüsste er nicht, was er tun solle (S. 269), dann erscheint er nicht nur blind, sondern auch überhaupt der menschlichen Fähigkeit beraubt, autonom zu urteilen. Zu den kritischen Implikationen des Buchs gehört ebenso, den Zynismus des Militärs, dessen Vertreter Opfer und Täter gleichzustellen, wenn sie über die Folgen der Vergewaltigungen sprechen, und die Heuchelei im Journalismus bloßzustellen.
Die Ergänzung der Geschichte um die Sekten-Handlung erweitert zugleich das parodistische Potential, indem die Prostitution nun nicht nur mit dem Militär, sondern auch mit einem Missionseifer parallelisiert wird, was wiederum ein verzerrtes Echo auf ein Kernthema aus dem Grünen Haus ist, dessen Schauplatz Santa María de Nieva im Frauenbatallon auch einmal angesprochen wird. Zusammen mit dem Familienleben des Hauptmanns sind es letztlich vier Lebenswelten, die sich miteinander groteskerweise spiegeln. Im Vergleich zum Sektenführer, der erst Tiere, dann einen Säugling kreuzigen lässt, und schließlich selbst am Kreuz stirbt, verläuft die Katastrophe des Hauptmanns milde. Indem er sich in seine Aufgabe hineinsteigert, verliert er zwar den Kontakt zu seiner Frau und dem neugeborenen Kind, und riskiert, aus der Armee entlassen zu werden, nachdem er in Uniform eine Traueransprache auf seine ermordete Geliebte gehalten hat – doch versöhnt er sich schließlich mit seiner Familie und darf, wenn auch strafversetzt, im Dienst bleiben. Diese Lösung ist insofern auch notwendig, weil der Werdegang der Figur zirkulär angelegt sein soll: Der Roman beginnt und endet damit, dass Pantaléon Pantoja von seiner Gattin geweckt wird. Die Figur bekommt auf diesem Weg neben ihrem komischen, auch einen bemitleidendswerten, tragischen Zug. Sie ist die einzige, die eine gewisse Charakterfülle gewinnt, während alle anderen wie Marionetten wirken.
Verschwinden des Erzählers
Narratologisch schlägt Vargas Llosa mit seinem fünften Roman einen neuen Weg ein, indem er die Erzählinstanz praktisch verschwinden lässt.7 Ein Gutteil der Kapitel besteht aus nicht-literarischen Texten: Militärische Depeschen und Berichte, Transkriptionen einer Radiosendung und eine Zeitungsreportage. Hinzu kommen Textformen, die zwar aus Figuren-Perspektive geschrieben sind, aber ebenfalls weniger einer Erzählung als Dokumenten eignen: ein Brief von Pochita, Pantajos Ehefrau, an ihre Schwester und eine Art Protokoll von Albträumen des Hauptmanns. Vargas Llosa bezeichnet diese starren Texte als einen notwendigen Ausgleich zu den übrigen Kapiteln, die zwar ebenfalls keinen eigentlichen Erzähler haben, aber aus lebendiger Sprache, nämlich Dialogen bestehen, in die allerdings wie Regie- oder Szeneanweisungen verknappte Handlungsbeschreibungen eingestreut sind – oft in Form von drei kurzen, asyndetischen Phrasen8 . Im Verlauf der Geschichte greifen diese Einschübe zeitlich und räumlich weiter aus9; der Autor erklärt hierzu, dass er den Leser mit dieser Darstellungsweise langsam vertraut machen wollte. Seine Idee, die redebegleitenden Anmerkungen (im Spanischen „acotaciones“) mit Informationen aufzuladen, begründet er damit, dass er diese in herkömmlichen Prosawerken als „tote Sprache“ empfindet.
Dialogisch sind die Kapitel 1, 3, 5, 8 und 10, die übrigen bestehen aus benannten Dokumenten. Mit der Ausnahme des sechsten Kapitels wechseln also beide Formen regelmäßig ab, und eine solche Kapitelalternation macht sich Vargas Llosa auch in manchen seiner späteren Werke wie Tante Julia und der Schreibkünstler oder Der Fisch im Wasser zu eigen.
Freies Bewegen in der Zeit
In den dialogischen Abschnitten begegnet die bekannte Montagetechnik des Schriftstellers: Verschiedene Gespräche werden miteinander vermischt, allerdings nicht mehr so kompliziert wie in den vorigen Romanen: Meist sind es nur zwei, leicht voneinander unterscheidbare Gesprächssituationen, die verwoben sind. Stärker ausgeprägt dagegen ist das Spiel mit der Zeit: Gespächsteile werden zum Teil in antichronologischer Reihenfolge präsentiert, d.h. Äußerungen, die logischerweise später fallen müssen als andere, erscheinen früher. Zeitsprünge enthalten auch manche der acotaciones, und in den Traumsequenzen wird die zeitliche Logik nicht nur unterlaufen, sondern ihr Bruch auch ausdrücklich thematisiert (S. 74).
Nach eigenem Bekunden schwebte Vargas Llosa bei diesem Buch vor, „eine Geschichte zu schreiben, die nur ein Gespräch sein würde, ein einziger Dialog […] nicht ein realistischer Dialog, sondern einer, den man einen Plural-Dialog nennen könnte, ein Dialog, der durch keinerlei Rücksichten auf Zeit oder Raum eingegrenzt würde. Er könnte frei in der Zeit hin und her bewegt werden, den Leser von der Gegenwart in die Zukunft oder in die Vergangenheit führen und wieder zurück in die Gegenwart […] Meine Sorge war allerdings, dass ein solcher Dialog dem Leser erkünstelt, dem Leben ziemlich fern erscheinen könnte. Um dieses Problem zu lösen, beschloss ich, den Leser nach und nach in dieses Dialogsystem einzuführen, nämlich ihn so langsam an die Freiheiten in Zeit und Raum zu gewöhnen, dass er die Wechsel und Verschiebungen in der Geschichte nicht ungädig aufnahm.“10 Indem sich die Geschichte frei von der Vergangenheit in die Zukunft und zurück bewegen kann, bekomme die Zeit eine räumliche, territoriale Eigenschaft, so der Autor weiter, die Zeit sei „wie der Raum, in dem nichts verlorengeht, nichts verschwindet. Zeit ist da. Die Vergangenheit ist wie die Zukunft oder wie die Gegenwart ein Schauplatz, zu dem du jederzeit zurückkehren kannst. […] Ich glaube, es begann mit dem Frauenbataillon, denn als ich das Buch schrieb, war ich zum ersten Mal von dieser formalen Möglichkeit fasziniert. Einer der Gründe, weshalb Literatur wichtig ist, liegt darin, dass sie uns ein Mittel liefert, mit dem wir Zeit verstehen können. Im wirklichen Leben verschlingt uns die Zeit, sind wir so in sie eingebettet, dass sie uns den Überblick über ihr Verfließen nimmt und damit den nötigen Abstand, um wirklich zu verstehen, was geschieht. Deshalb brauchen wir zum Verständnis der Zeit eine künstliche Ordnung.“ Es sei einer der bedeutendsten Beiträge der Literatur, dass sie eine solche künstliche Ordnung errichten, die den Menschen helfe, sich weniger verloren und verwirrt zu fühlen. 11
Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass der Roman, obwohl er deutlich kürzer und weniger komplex als die vorigen Werke Vargas Llosa ist, einen darüber hinausgehenden Hintersinn hat. Vargas LLosa spricht von einem „experimentellen Roman“; es sei „wohl das Buch, bei dem ich mir der Form am meisten bewusst war, der rein technischen Aspekte in der Schaffung des Romans […] Am Hauptmann und sein Frauenbataillon habe ich genauso viel wie an meinen anderen Büchern gearbeitet und mich wahrscheinlich angestrengter bemüht, zu experimentieren“.12 Das allein hört sich nach einem verkopften, schwer verdaulichen Kunstwerk an – wenn der Inhalt nicht in die Gegenrichtung, sozuasagen zum Unterleib, zur leichten Unterhaltung mit erotisch-frivolen Themen strebte. Die Kombination beider Tendenzen ist vielleicht das Verblüffendste an dem Buch. Unterm Strich ist es, gemessen an Verkauf und Auflage, erfolgreicher als die Romane, mit denen Vargas Llosa berühmt wurde.
- MVLL: Die Wirklichkeit des Schrifstellers. Suhrkamp 1997, S. 110. ↩︎
- Im Folgeroman wächst sich das dahingehende aus, das „Gemachte“ von Literatur offenbar wird. Ansätze gibt es im Hauptmann auch, etwa der Sprachfehler eines Chinesen erst auf Pantoja, dann auf einen anderen General überspringt (S. 73). ↩︎
- Zuallerst erst der des Protagonisten Pantaleón Pantoja ↩︎
- Die Wirklichkeit des Schrifstellers. S. 107. ↩︎
- Ebenda S. 145. ↩︎
- Ebenda S. 114. ↩︎
- Wobei dieses Bestreben schon beim Schreiben der Kathedrale und der Jungen Hunde vorhanden war, liegt den Werken doch die Idee zugrunde, das Dargestellte stamme nicht aus dem Mund eines klassischen Erzählers, sondern sei die Wiedergaben von Gesprächen oder eines chorischen Kollektivs. ↩︎
- Beispielsweis: „‚Schließlich ist Iquitos eine Stadt, Panta, und sie scheint hübsch zu sein‘. Pochita wirft Lappen in den Müll, macht Knoten, schließt Taschen. ‚Mach nicht so ein Gesicht; die Hochebene wäre schlimmer gewesen, hm?“ (S. 14) ↩︎
- Währned am Anfang des Buches alle acotaciones unmittelbar mit der Gesprächssituation zu tun haben begeben wir an dessem Ende bespielsweise diesem Einschub: „General Scavino begibt sich in spezieller Mission nach Lima, besucht Politiker, erbittet Audienzen, rät, intrigiert, untersucht, kehrt nach Iquitos zurück“ (S. 226) ↩︎
- MVLL: Die Wirklichkeit des Schriftstellers. Suhrkamp 1997, S. 116 f. ↩︎
- Ebenda S. 122. ↩︎
- Ebenda S. 128. ↩︎